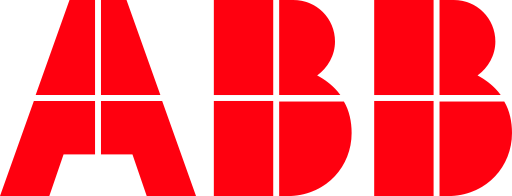Die folgende Ausarbeitung zum Thema Konstantlichtregelung soll ausreichende Hintergrundinformationen geben,
– um die Wirkungsweise einer Konstantlichtregelung besser zu verstehen,
– um den für die Erfassung des Istwertes notwendigen Lichtfühler optimal platzieren zu können,
– um kritische Umgebungsbedingungen, welche die Funktion der Konstantlichtregelung negativ beeinfl ussen können, zu erkennen und
– um die durch die Physik gesetzten Grenzen der Konstantlichtregelung beurteilen zu können.
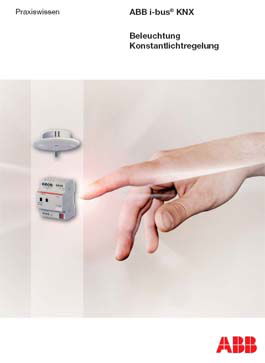
Dazu ist es auch notwendig, sich mit den wichtigsten Begriffen der Lichttechnik zu befassen.
Wie funktioniert die Konstantlichtregelung?
Bei der Konstantlichtregelung misst ein an der Decke montierter Lichtfühler die Leuchtdichte der Flächen in seinem Erfassungsbereich, z. B. des Bodens oder der Schreibtische.
Diesen Messwert (Istwert) vergleicht er mit dem vorgegebenen Sollwert und führt die Stellgröße so nach, dass die Abweichung zwischen Soll- und Istwert minimal wird. Wird es draußen heller, dann wird der Anteil des Kunstlichtes reduziert. Wird es draußen dunkler, wird der Anteil des Kunstlichtes erhöht. Die genaue Funktion des Lichtreglers selbst ist in dem Handbuch des Lichtreglers LR/Sx.16.1 im Detail beschrieben. Bei der Einstellung des Sollwertes wird ein Luxmeter verwendet, das unterhalb des Lichtfühlers zu platzieren ist, z. B. auf einem Schreibtisch. Dieses Luxmeter erfasst die Beleuchtungsstärke, mit der die Flächen unterhalb des Lichtfühlers beleuchtet werden.
Das Ziel einer Konstantlichtregelung ist, die beim Setzen des Sollwertes eingestellte Beleuchtungsstärke konstant zu halten. Um das perfekt realisieren zu können, müsste der Lichtfühler genau an der Stelle platziert werden, an der das Luxmeter zur Einstellung des Sollwertes platziert war, um ebenfalls dort die Beleuchtungsstärke zu erfassen. Da dies jedoch aus praktischen Gründen nicht möglich ist, wird der Lichtfühler üblicherweise an der Decke montiert. Dies ist ein Kompromiss. Denn zur Referenz-Einstellung des Sollwertes wird zwar zur Messung der Beleuchtungsstärke ein Luxmeter verwendet, der Lichtregler hingegen erfasst primär die Leuchtdichte unterhalb des Lichtfühlers. Dadurch hält der Lichtregler indirekt die Beleuchtungsstärke konstant.
Wenn bei dieser indirekten Messung bestimmte Randbedingungen nicht beachtet werden, kann es dazu führen, dass eine Konstantlichtregelung überhaupt nicht oder nur unzureichend funktioniert.
Das ist kein spezifisches Problem unserer Konstantlichtregelung, sondern betrifft alle Konstantlichtregelungen.
Was ist der Unterschied zwischen Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte?
Um die mit der indirekten Messung verbundene Problematik zu verstehen, ist es notwendig, sich mit den wichtigsten Begriffen der Lichttechnik auseinander zu setzen. Es werden nur die Grundbegriffe erklärt und dabei auf die genaue Erklärung bzw. mathematische Herleitung komplexerer Begriffe, z.B. Lichtstärke = Lichtstrom/Steradiant, verzichtet.
Ein Leuchtmittel, z. B. eine Leuchtstoffröhre, wandelt elektrische Energie in Licht um. Die von einer Lichtquelle ausgehende Strahlung wird als Lichtstrom bezeichnet. Die Einheit ist das Lumen [lm]. Leuchtmittel wandeln die zugeführte elektrische Leistung mit unterschiedlichem Wirkungsgrad in Licht um.
Neben dem Lichtstrom gibt es den Begriff Lichtstärke, sie wird auch als Lichtstromdichte bezeichnet. Die Lichtstärke wird in Candela [cd] gemessen. Candela ist die Maßeinheit für die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung (Raumwinkel) abgestrahlte Lichtstärke. Eine genauere Definition der Lichtstärke führt zu sehr in die Mathematik, z. B. die Erklärung von Steradiant.
Vereinfacht gilt: Eine Lichtstärke von 1cd liegt vor, wenn 1m entfernt von der Lichtquelle die Beleuchtungsstärke 1 lx gemessen wird.
Der von einer Lichtquelle ausgehende Lichtstrom beleuchtet die Flächen, auf die er auftritt. Die Intensität, mit der die Flächen beleuchtet werden, wird als Beleuchtungsstärke bezeichnet. Die Beleuchtungsstärke hängt von der Größe des Lichtstroms und der Größe der Flächen ab.
Sie ist wie folgt definiert:
E = Φ/ A [lx=lm/m²]
E = Beleuchtungsstärke
Φ = Lichtstrom in lm
A = beleuchtete Fläche
Gemäß der obigen Tabelle erzeugt eine 100-W-Glühlampe mit 15 lm/W maximal einen Lichtstrom von 1500 lm. Würde der gesamte Lichtstrom der Glühlampe nicht kugelschalenartig in den Raum abgestrahlt, sondern gebündelt und gleichmäßig verteilt auf einer Fläche von 1 m² auftreffen, dann wäre der Wert der Beleuchtungsstärke auf jedem Punkt dieser Fläche 1500 lx. Die empfundene Helligkeit einer beleuchteten Fläche hängt von der Beleuchtungsstärke und dem Reflexionsgrad der beleuchteten Fläche ab. Der Reflexionsgrad ist der von einer beleuchteten Fläche reflektierte Teil des auf sie fallenden Lichtstroms. Typische Werte für den Reflexionsgrad sind:
90 % blank poliertes Silber
75 % weißes Papier
65 % blank poliertes Aluminium
20 – 30 % Holz
< 5 % schwarzer Samt
Die Einheit, mit der angegeben wird, wie hell eine beleuchtete oder auch eine selbst leuchtende Fläche (z.B. LCD-Bildschirm) empfunden wird, ist die Leuchtdichte. Die Einheit der Leuchtdichte ist cd/m².
Wenn z. B. weißes Papier einer Beleuchtungsstärke von 500 lx ausgesetzt ist, dann beträgt die Leuchtdichte etwa 130 – 150 cd/m². Bei der gleichen Beleuchtungsstärke hat ein Umweltschutzpapier nur eine Leuchtdichte von 90 – 100 cd/m².
Klicken Sie hier für weitere Informationen: https://new.abb.com/de/ueber-uns/geschaeftsbereiche/elektrifizierung?utm_source=voltimum&utm_medium=textlink&utm_campaign=voltimum-DE