Halbleiterwerkstoffe haben einen kristallinen Aufbau. In einem Halbleiterkristall existiert das sogenannte Valenzband, das die Energie der gebundenen Elektronen der Atome repräsentiert und ein höheres Energieband, genannt das Leitungsband, das die Energie der im Kristall frei beweglichen Elektronen charakterisiert.
Bei Zimmertemperatur ist die thermische Energie groß genug, um einige Atome des Halbleitermaterials zu ionisieren. Es existiert daher eine geringe aber entscheidende Leitfähigkeit, deren Existenz den Namen Halbleiter geprägt hat. Sie ist etwa um das 105fache geringer als die von Metallen, aber größer als die von Isolierstoffen. Wird einem Elektron genügend Energie zugeführt, um seinem Mutteratom zu entkommen, so bewegt es sich willkürlich durch das Material, bis es ein ionisiertes Atom, ein sogenanntes Loch, trifft, mit dem es rekombiniert. Durch den Rekombinationsprozess verliert es die Energie, die der Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband entspricht. Diese Energie kann in Form eines Photons abgegeben werden und bestimmt die Wellenlänge des emittierten Lichts.
Die Zahl der beweglichen Ladungsträger lässt sich stark erhöhen, wenn der Halbleiter dotiert wird, d.h. dass in das Kristallgitter Störstellen in Form von höher- bzw. geringerwertigen Fremdatomen eingebaut werden.
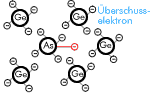 |
Beispielsweise bleibt beim Einbau von Arsenatomen (As) in ein Germaniumgitter (Ge) jeweils das fünfte Valenzelektron übrig, da es nicht zur Bindungsbildung benötigt wird. Schon bei Zimmertemperatur wandert es frei durch das Gitter. Man bezeichnet das Arsenatom als Donator (Elektronenspender), da es durch Abgabe eines Elektrons die Elektronenleitung ermöglicht. Diesen Halbleiter mit überschüssigen Leitungselektronen nennt man n-Leiter. n-Leiter sind durch Fremdatome mit höherer Wertigkeit dotierte Halbleiter. |
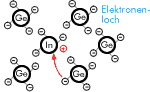 |
Ein Atom mit nur drei Valenzelektronen, z.b. Indium, wird dagegen als Akzeptor (Elektronenfänger) bezeichnet. Bei diesem wandert ein positiver Ladungszustand durch das Fehlen eines Elektrons frei durch das Gitter, der eine Löcherleitung ermöglicht. Man bezeichnet diesen Halbleiter als p-Leiter. p-Leiter sind durch Fremdatome mit kleinerer Wertigkeit dotierte Halbleiter. |
Halbleiterdioden
Stoßen zwei Halbleiterzonen verschiedener Leitungsart aneinander, so entsteht ein pn-Übergang. Er bildet die Grenzschicht zwischen einem p-Leiter und einem n-Leiter. Es diffundieren negative Ladungsträger (Elektronen) vom n-Leiter in den p-Leiter und positive Ladungsträger (Löcher) vom p-Leiter in den n-Leiter. Dabei finden Rekombinationen statt. Die Leitungselektronen der Grenzschicht werden zu gebundenen Valenzelektronen, und die Löcher verschwinden. In der Grenzschicht halten sich keine beweglichen Ladungsträger mehr auf.
Die Diffusion beeinflusst die Lage der Ionen, welche im Halbleiter ortsfest sind, nicht. Deshalb verbleibt in der Grenzschicht des n-Leiters nach Abwandern der Elektronen eine positive Ladung. Entsprechend erhält der p-Leiter in der Grenzschicht eine negative Ladung. Die Ladungen innerhalb der Grenzschicht bewirken eine Spannung am pn-Übergang, die ein weiteres Eindringen von Ladungsträgern in die Grenzschicht verhindert. Der Ladungstransport wird dort gesperrt. Somit wird die Grenzschicht zu einer Sperrschicht.
Sperrrichtung und Durchlassrichtung
Die Sperrschichtbreite nimmt bei Anlegen der Spannung zu, wenn der Pluspol der Spannung am n-Leiter und der Minuspol am p-Leiter liegen. Diese Richtung der Polung nennt man Sperrrichtung. In Sperrrichtung ist der Widerstand (Sperrwiderstand) groß. Es fließt nur ein kleiner Sperrstrom.
Die Sperrschichtbreite nimmt beim Anlegen der Spannung ab, wenn der Minuspol der Spannung am n-Leiter und der Pluspol am p-Leiter liegt. Diese Richtung der Polung nennt man Durchlassrichtung. In Durchlassrichtung ist der Widerstand (Durchlasswiderstand) klein. Es fließt der Durchlassstrom (Vorwärtsstrom).
Dioden werden z.b. zur Gleichrichtung von Wechselstrom genutzt.
Ein pn-Übergang hat elektrisch die Funktion einer Diode.
 |
Blockschaltbild der LED Für die Diodenanschlüsse wurden die Bezeichnungen Anode und Katode von der Röhrendiode übernommen. Man versteht unter Anode die positive Elektrode (p-Schicht) und unter Katode die negative Elektrode (n-Schicht). |