Warenkorb
0 Punkte
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
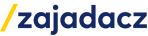
Unbekannt
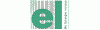
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
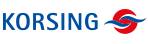
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
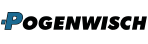
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
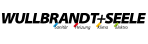
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
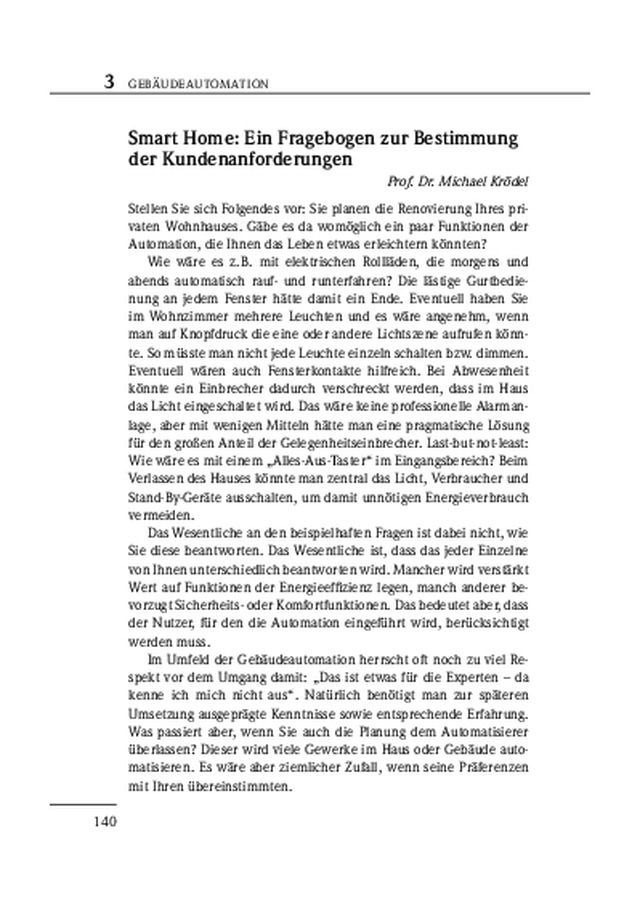

Smart Home: Ein Fragebogen zur Bestimmung der Kundenanforderungen
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie planen die Renovierung Ihres privaten Wohnhauses. Gäbe es da womöglich ein paar Funktionen der Automation, die Ihnen das Leben etwas erleichtern könnten?
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 140 Smart Home: Ein Fragebogen zur Bestimmung der Kundenanforderungen Prof. Dr. Michael Krödel Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie planen die Renovierung Ihres pri-vaten Wohnhauses. Gäbe es da womöglich ein paar Funktionen der Automation, die Ihnen das Leben etwas erleichtern könnten? Wie wäre es z. B. mit elektrischen Rollläden, die morgens und abends automatisch rauf- und runterfahren? Die lästige Gurtbedie-nung an jedem Fenster hätte damit ein Ende. Eventuell haben Sie im Wohnzimmer mehrere Leuchten und es wäre angenehm, wenn man auf Knopfdruck die eine oder andere Lichtszene aufrufen könn-te. So müsste man nicht jede Leuchte einzeln schalten bzw. dimmen. Eventuell wären auch Fensterkontakte hilfreich. Bei Abwesenheit könnte ein Einbrecher dadurch verschreckt werden, dass im Haus das Licht eingeschaltet wird. Das wäre keine professionelle Alarman-lage, aber mit wenigen Mitteln hätte man eine pragmatische Lösung für den großen Anteil der Gelegenheitseinbrecher. Last-but-not-least: Wie wäre es mit einem „Alles-Aus-Taster“ im Eingangsbereich? Beim Verlassen des Hauses könnte man zentral das Licht, Verbraucher und Stand-By-Geräte ausschalten, um damit unnötigen Energieverbrauch vermeiden. Das Wesentliche an den beispielhaften Fragen ist dabei nicht, wie Sie diese beantworten. Das Wesentliche ist, dass das jeder Einzelne von Ihnen unterschiedlich beantworten wird. Mancher wird verstärkt Wert auf Funktionen der Energieeffizienz legen, manch anderer be-vorzugt Sicherheits- oder Komfortfunktionen. Das bedeutet aber, dass der Nutzer, für den die Automation eingeführt wird, berücksichtigt werden muss. Im Umfeld der Gebäudeautomation herrscht oft noch zu viel Re- spekt vor dem Umgang damit: „Das ist etwas für die Experten – da kenne ich mich nicht aus“. Natürlich benötigt man zur späteren Umsetzung ausgeprägte Kenntnisse sowie entsprechende Erfahrung. Was passiert aber, wenn Sie auch die Planung dem Automatisierer überlassen? Dieser wird viele Gewerke im Haus oder Gebäude auto-matisieren. Es wäre aber ziemlicher Zufall, wenn seine Präferenzen mit Ihren übereinstimmten. jb2015_gt.indb 140 18.08.2014 13:19:21 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 141 Kein Wunder also, dass insbesondere Nutzer in Büros mit der Automation oft nicht zufrieden sind. Jalousien fahren zu nicht nach-vollziehbaren Zeiten; mit der Raumtemperatur ist man unzufrieden und die Beleuchtung lässt sich nicht richtig bedienen. In Konsequenz wird oft über die Automation geschimpft. Dabei müssen Sie aber bitte beachten: Da kann die Automation nichts dafür. Diese macht einfach nur ihren Job – und das ausgesprochen zuverlässig. Man sollte eher mal mit dem Automatisierer sprechen, der die Anlage und deren Ver-halten programmiert hat. Meist kann der aber auch nichts dafür, weil ihm keine konkreten Vorgaben über die Nutzung des Gebäudes bzw. die Präferenzen der späteren Nutzer gegeben wurden. Damit haben wir auch den Bezug zum Nichtwohngebäude. Dieser Artikel begann zwar mit einem Beispiel für das eigene Wohngebäude – gilt aber gleichermaßen auch für z. B. Büros, Restaurants, Schulen, etc. Kurz: überall dort, wo der Mensch von der Automation betroffen ist. Ein deutsches Sprichwort empfiehlt, „… die Rechnung nicht ohne den Wirt zu machen“ . Auf die Gebäudeautomation angewandt heißt das: Überlegen oder analysieren Sie vor der Umsetzung, welche Funk-tionen sinnvoll sind und später aus Nutzersicht als angenehm emp-funden werden. Im weiteren Verlauf fokussiert sich der Artikel bewusst auf die Raumautomation, also auf die Funktionen der Gebäudeautomation, die sich im Raum abspielen und denen der Nutzer in besonderem Maße ausgesetzt ist. Dabei werden auch Checklisten und Hinwei-se vorgestellt, um die Anwendung auf konkrete objekte zu ermög-lichen. Die besondere Verantwortung von Architekten, Bauingenieuren, Fachplanern, etc. Wer legt nun aber fest, welche Anforderungen an die Automation aufzunehmen sind und definiert diese? Grundsätzlich ist dies die Aufgabe des Bauherrn oder Nutzers. ohne eine entsprechende Be-ratung sind diese Personen jedoch in der Regel nicht in der Lage, die Anforderungen an die Automation vollständig und umfassend zu definieren. Somit fällt den Architekten und Bauingenieuren eine be-sondere Verantwortung zu, die Anforderungen gemeinsam mit dem jb2015_gt.indb 141 18.08.2014 13:19:21 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 142 Nutzer oder Bauherren festzulegen. Alternativ kann ein Fachplaner für Gebäudeautomation eingesetzt werden, der die Anforderungen an die Automation zusammen mit dem Bauherrn aufnimmt, doku-mentiert und auf dieser Grundlage eine nutzergerechte Planung der Gebäudeautomation erstellt. Mangelndes Verständnis und falscher Respekt für dieses Gewerk führen in der Praxis aber oft dazu, dass die Anforderungen an die Automation nicht definiert werden, bzw. sich niemand der sorgfältigen Planung von diesem Gewerk widmet. Was da herauskommt, kann nicht auf die individuellen Bedürfnisse des Bauherrn bzw. der Nutzer passen. An dieser Stelle sei nochmal betont, dass der Nutzer in ausgespro- chen hohem Maße den Auswirkungen der Raumautomation ausge-setzt ist. Natürlich merkt der Mensch im Raum sofort, ob und wie die Rollläden gefahren werden, ob und wie das Licht geregelt wird und wie sich die Temperatur im Raum verändert. Die Anlagenautomation, d.h. die Automation von Anlagenkomponenten wie z. B. Heizungs-anlage, Lüftungs- oder Klimaanlage, etc. ist aus Nutzersicht weniger kritisch. Dort darf auch ohne Befragung des Nutzers entschieden wer-den, wann z. B. eine Umwälzpumpe eingeschaltet wird. Eine besondere Bedeutung erhält die Bedienung. Wir sind es seit Geburt an gewohnt, dass einfache Taster/Schalter neben der Tür das Licht ein-/ausschalten. Natürlich ist es möglich, den einfachen Schal-ter durch ein komplexes Touchpad zu ersetzen. Es sollte aber nicht verwunderlich sein, wenn die meisten Nutzer nicht damit zurecht-kommen. Somit sollte die Bedienung der wichtigsten Funktionen (Licht an/aus; Rollladen hoch/runter) nach wie vor über einfache Taster erfolgen. Im privaten Gebäude sollten dazu maximal 2-fach- Taster und im Büro maximal 4-fach-Taster verwendet werden. Ein Bedientableau oder die Bedienung über Smartphone sollte immer nur als ergänzende Bedienmöglichkeit eingeplant werden – wenn über-haupt. Auch 8-fach-Taster sollten nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Zur Bedienung sei betont: Man muss nicht Automatisierer sein, um die Anforderungen an die Bedienung vorzugeben. Es ist genau umgekehrt: Die Vorgaben macht ein „normaler“ Mensch bes-ser als der Automationsexperte. Unter Wikipedia ist unter „Automation“ unter anderem zu lesen: „… die mit Hilfe von Maschinen realisierte Übertragung von Arbeit vom Menschen auf Automaten …“ jb2015_gt.indb 142 18.08.2014 13:19:21 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 143 Das bedeutet: Dem Menschen muss Arbeit abgenommen werden, d. h. das Leben muss für den Menschen einfacher und angenehmer werden. Wenn die (Raum-) Automation bewirkt, dass der Mensch den Raum nicht mehr richtig bedienen kann oder sich fremdbestimmt fühlt, wird die Automation ihrer Bestimmung nicht gerecht. Dann hat irgendjemand etwas ziemlich falsch gemacht! Deshalb nochmals der Appell an die Architekten und Bauingenieu- re, entsprechende Vorgaben zu Funktionen und Bedienung vom Bau-herren einzufordern bzw. gemeinsam mit diesem zu definieren oder einen versierten Fachplaner für Gebäudeautomation einzusetzen. Sinnvolle Funktionen aus der Sicht des Nutzers Was will nun aber der Nutzer? Wenn Sie es selber sind: Nehmen Sie sich die Zeit und machen sich in Ruhe Gedanken darüber. Wenn es eine Einzelperson ist, dann sprechen Sie mit ihr. Bei einer ganzen Zielgruppe hilft eine Kundenbefragung. In allen Fällen benötigen Sie einen Satz an Fragen, die gestellt werden. Wichtig ist dabei, dass die Fragen den Nutzen wiederspiegeln. Vermeiden Sie den typischen Fehler, die Fragen bereits zu technisch zu formulieren. Sätze wie z. B. „Bevorzugen Sie ein Bus-System oder binäre Taster?“ sind nicht sinnvoll. Ebenso macht es sicher keinen Sinn, frühzeitig nach einer Präferenz zu „KNX, LoN, DALI oder Enocean“ zur Lichtsteuerung zu fragen. Aber selbst scheinbar harm-lose Stichworte wie „Präsenzmelder“, „Temperaturregelung“ oder „Controller“ sollten komplett vermieden werden. Achten Sie darauf, dass sich die Abfrage ausschließlich auf den Nutzen fokussiert und in keiner Weise die dazu nötige Technik wiederspiegelt. Immerhin muss es bei diesem ersten Schritt komplett egal sein, wie später die gewünschten Funktionen umgesetzt werden. Die in Bild 1 dargestellte „vereinfachte Checkliste“ ist ein stark komprimiertes Beispiel. Aber selbst diese ermöglicht ein grobes Bild, welche Art von Funktionen gewünscht, bzw. abgelehnt wird. Dabei hat eine Checkliste noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. In seinem Buch „Die Kunst des Überzeugens“ beschreibt Robert Cialdini unter anderem das Phänomen, dass Kunden eher zur Kauf einer Ware bereit sind, wenn sie sich vorher positiv dazu geäu-ßert haben. Wenn ein Nutzer angibt, dass er z. B. die Abschaltung von jb2015_gt.indb 143 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 144 Grundsätzlich interessieren mich die folgenden Möglichkeiten durch mo- derne Gebäudetechnik: £ Ich möchte Energie sparen: Das übermäßige Heizen oder Beleuchten soll vermieden werden. Auch soll sich die Heizung bei Abwesenheit oder geöffneten Fenstern automatisch abschalten. £ Mit einem „Alles-Aus“-Taster im Eingangsbereich möchte ich bei Abwesenheit zur Sicherheit verschiedene Verbraucher ausschalten können; auch möchte ich dadurch Stand-By-Verluste vermeiden. £ Ich wünsche zusätzliche Sicherheit: Einbrüche sollen weitgehend vermieden bzw. Einbrecher verschreckt werden; Störungen wie Brände oder Rohrbrüche sollen erkannt und alarmiert werden. £ Rollläden/Jalousien sollen selbständig fahren, damit ich diese nicht 2 x täglich selber bedienen muss. £ Bei mehreren Leuchten in einem Raum sollen diese über Lichtszenen bedient werden – so muss ich nicht jede Leuchte einzeln schalten, bzw. dimmen. £ Warum sind Schalter nur an der Wand? Ich hätte sie gerne auch dort, wo ich sie brauche, z. B. am Schreibtisch, Couchtisch, Bettkasten etc. £ Die Bedienung muss einfach und intuitiv sein. Auch müssen die Funktionen kostengünstig sein – insbesondere bei Nachrüstung in Bestandsgebäuden. Bild 1: Vereinfachte Checkliste Nein, ich verzichte auf Unterstützung durch moderne Gebäudetechnik und möchte auch in Zukunft: £ regelmäßig selber im Haus nachsehen, ob alle Verbraucher ausgeschaltet sind, £ nur einmal pro Jahr eine Energieverbrauchsabrechnung erhalten (auch wenn daraus keine Energieverschwender ermittelt werden können), £ im Urlaub oder bei Abwesenheit in Sorge sein, das eine oder andere Gerät ange- lassen zu haben, £ täglich selber alle Rollläden/Jalousien per Gurt rauf- und runterlassen, bzw. einzeln bedienen, £ selbst bei mehreren Leuchten in einem Raum jede Leuchte einzeln schalten/ dimmen, £ Schäden an Geräten (z. B. Rohrbruch) nicht gemeldet zu bekommen und somit das Risiko für größere Folgeschäden eingehen, £ nachts oder im Urlaub regelmäßig besorgt sein, dass eingebrochen werden könnte, £ jede Nacht Gefahr laufen, einen Brand nicht alarmiert zu bekommen bzw. einen Rauchmelder in einem anderen Raum nicht zu hören, £ regelmäßig Energie verschwenden, da oft zu falschen Zeiten geheizt/beleuchtet wird und Stand-by-Verbraucher permanent an sind. jb2015_gt.indb 144 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 145 Stand-By-Verbrauchern bei Abwesenheit als sinnvoll ansieht, so kann er anschließend nicht mehr richtig dagegen sein. Mehr noch – die Bereitschaft, eine entsprechende Investition zu tätigen, ist bei einem zweistufigen Prozess (Abfrage und Angebot) deutlich höher, als wenn etwas direkt angeboten wird. Dieser psychologische Aspekt sollte nicht der Hauptfokus sein. Der wesentliche Punkt sollte immer sein, die Wünsche und Einschät-zungen des Kunden besser zu kennen. Wenn aber der psychologische Aspekt hilft, die daraus ermittelten Funktionen einfacher verkaufen zu können, ist das ein nicht unwesentlicher Nebenaspekt. In einigen Fällen ist womöglich eine detailliertere Befragung sinn- voll. Unter [1] ist eine Checkliste ca. 30 Fragen auf vier Seiten ver-fügbar, wie sie von Philipp Eigl im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Hochschule Rosenheim verwendet wurde. Dabei war das Durch-schnittsalter der Befragten bei etwas über 30 Jahre und es herrschte fast Gleichverteilung zwischen Frauen und Männern. Bild 2 zeigt das Ergebnis der Auswertungr. Interessant ist, dass Funktion des Fern-zugriffs recht schlecht abgeschnitten hat, obwohl die Teilnehmer zur Smartphone-Generation gehören. Auch lagen Funktionen für die Einbindung von Videokameras oder Unterhaltungselektronik (Stereo-anlage, Fernseher, etc.) im Mittelfeld und sind deshalb in Bild 2 nicht aufgeführt. Die Schwerpunkte lagen auf Energieeffizienz durch Ein-zelraumregelung sowie einige Sicherheits- und Komfortfunktionen. Auch wenn eine größere Zielgruppe untersucht werden soll, emp- fiehlt es sich, zumindest einen Teil der Befragungen im persönlichen Gespräch durchzuführen. online-Befragungen haben zwar den Vor-teil der pragmatischen Massenabwicklung – eine Antwort „zwischen den Zeilen“ ist aber nicht möglich. Im Rahmen einer persönlichen Befragung kommt oft der Grund für eine Ablehnung einiger Funktio-nen zum Vorschein und offenbart so manches Missverständnis. Im Rahmen eines Gesprächs ist der Verlauf sehr interessant. oft weicht eine anfängliche Skepsis einem vermehrten Zuspruch, nachdem die Vorteile und der Nutzen erkannt wurden. Die Erkenntnis, wo und warum zunächst Vorurteile herrschten, sind ein wesentlicher Gewinn für die Anpassung der Fragestellung und das Kundenverständnis. jb2015_gt.indb 145 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 146 Bild 2: Bewer tung der Funktionen „Kundenakzeptanz allgemein“ zentraler Ein-/Ausschalter 2,0 1,0 3,0 4,0 Abneigung von Metall im Bettbereich tageslichtabhängige Regelung (Küchenleuchten) präsenzgesteuerte Beleuchtung integrierte Audio-Anlage in der Küche höhenverstellbare Oberschränke Abneigung von "Elektrosmog" im Schlafzimmer Weckvorgang über zunehmendes Licht/Musik Orientierungsbeleuchtung am Bett Einklemmschutz an motorischen Türen/Schubladen Kollissionsschutz Schranktüren/Schubladen elektrische T ischverlängerung höhenverstellbare Schubladen elektrisch verstellbarer Lattenrost motorisches Öffnen von Schubladen/Türen Touchpanel in der Küche Beleuchtungssteuerung über Smartphone positionsabhängige Beleuchtung integrierte Musikanlage im Bett integrierter Fernseher in der Küche Wichtigkeit „Alles-Aus“-Schalter Videokamera Eingangstür diverse Notrufknöpfe Alarmanlage mit automatischem Notruf Verbrauchsanzeige Anwesenheitssimulation Überprüfung der Sensorik beim V erlassen der W ohnung Armband mit Vitaldatenüber wachung Einzelraumregelung Heizung Heizungsregelung beim V erlassen oder Öffnen von Fenstern automatische W ohnraumlüftung intelligenter Medikamentenschrank Videokomunikationssystem mit Betreuung automatisches Licht T oilettengang Chipsystem Eingangstür Touchscreen Fernbedienung für Alles automatische Fenster Infosystem über Fernseher höhenverstellbare Schränke Lichtszenarien zeitgesteuerte Rollläden automatische Gartenbewässerung Sprachsteuerung PC-Steuerung 2,0 1,0 3,0 4,0 Wichtigkeit Zentraltaster „Alles-Aus“ Einzelraumregelung der Heizung vernetzte Rauchmelder Abschaltung der Heizung bei offenen Fenstern Rohrbruch- und Leckagerekennung/-alarmierung Fluchtwegsicherung im Brandfall präsenzgeregelte Heizung Gruppensteuerung der V erschattung Smartphone-Steuerung der Heizung Anwesenheitssimulation Gruppensteuerung der Beleuchtung Beleuchtung/V erschattung in Einbruchsfall Verschattung gesteuert dur ch Außenhelligkeit präsenzgesteuerte Beleuchtung Smartphone-Steuerung von allg. V erbrauchern Beleuchtungsszenen Netzfreischaltung automatische W ohnraumlüftung Smartphone-Steuerung der V erschattung Paniktaster 2,0 3,0 4,0 5,0 Wichtigkeit jb2015_gt.indb 146 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 147 Ausstattungspakete Kurzer Szenenwechsel: Lassen Sie uns ein Auto kaufen. Nach dem Weg zum Autohändler unserer Wahl suchen wir zunächst ein Grund-modell aus. Dazu gibt es dann Ausstattungspakte wie „Family“ „Sport&Fun“ oder „Rolling Stones“. Diese sollen entsprechende Ziel-gruppen ansprechen: sowohl aufgrund des Namens als auch aufgrund des Inhalts. Man hat im Vorfeld offensichtlich die möglichen Zielgrup-pen untersucht und entsprechende Ausstattungspakte gebildet. Zurück zur Raumautomation: Wäre hier etwas Ähnliches auch sinnvoll? Wenn man von seiner Zielgruppe die Präferenzen kennt, köntte man diese auch direkt als Paket anbieten. Der Vorteil ist gleich zweifach. Zum Einen vermeidet man die individuelle Diskus-sion jeder einzelnen Funktion. Zum Anderen wird die Umsetzung einfacher: Wenn nicht jedes Haus/Gebäude individuell automatisiert wird, kann die Abwicklung und spätere Betreuung deutlich effizien-ter und damit auch deutlich günstiger erfolgen. Nehmen Sie sich die Automobilindustrie als Vorbild! Praxisbeispiele Zwei Einsatzgebiete der Automation im privaten Umfeld wurden be-reits im Rahmen von Abschlussarbeiten an der Hochschule Rosen-heim untersucht. Eine Studie von Kay Mattausch [2] untersuchte den Einsatz von Automation für das altersgerechte Wohnen. Der Hintergrund ist der demographische Wandel. Menschen werden immer älter und im Alter wird einiges beschwerlicher. Nun möchte man aber so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Wo kann da die Automation helfen, das Leben einfacher und/oder sicherer zu gestalten? Ganz wesentlich war hier die Analyse aus Sicht der betroffenen Personen. Dabei lag das Alter der befragten Personen im Bereich von 51 bis 85 Jahren (Durchschnitt: 64 Jahre). Bild 3 zeigt die Be-wertung der Funktionen durch diese Zielgruppe. In Summe war der zentrale Ein-/Ausschalter das Highlight und ist ein schönes Beispiel für „intelligente Raumfunktion“. Es wäre nicht sinnvoll, das ganze Haus beim Verlassen komplett spannungsfrei zu schalten. So wäre unter anderem die Tiefkühltruhe auch ausgeschaltet. Also muss jb2015_gt.indb 147 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 148 Bild 3: Bewer tung der Funktionen „Altersgerechtes W ohnen“ [2] zentraler Ein-/Ausschalter 2,0 1,0 3,0 4,0 Abneigung von Metall im Bettbereich tageslichtabhängige Regelung (Küchenleuchten) präsenzgesteuerte Beleuchtung integrierte Audio-Anlage in der Küche höhenverstellbare Oberschränke Abneigung von "Elektrosmog" im Schlafzimmer Weckvorgang über zunehmendes Licht/Musik Orientierungsbeleuchtung am Bett Einklemmschutz an motorischen Türen/Schubladen Kollissionsschutz Schranktüren/Schubladen elektrische T ischverlängerung höhenverstellbare Schubladen elektrisch verstellbarer Lattenrost motorisches Öffnen von Schubladen/Türen Touchpanel in der Küche Beleuchtungssteuerung über Smartphone positionsabhängige Beleuchtung integrierte Musikanlage im Bett integrierter Fernseher in der Küche Wichtigkeit „Alles-Aus“-Schalter Videokamera Eingangstür diverse Notrufknöpfe Alarmanlage mit automatischem Notruf Verbrauchsanzeige Anwesenheitssimulation Überprüfung der Sensorik beim V erlassen der W ohnung Armband mit Vitaldatenüber wachung Einzelraumregelung Heizung Heizungsregelung beim V erlassen oder Öffnen von Fenstern automatische W ohnraumlüftung intelligenter Medikamentenschrank Videokomunikationssystem mit Betreuung automatisches Licht T oilettengang Chipsystem Eingangstür Touchscreen Fernbedienung für Alles automatische Fenster Infosystem über Fernseher höhenverstellbare Schränke Lichtszenarien zeitgesteuerte Rollläden automatische Gartenbewässerung Sprachsteuerung PC-Steuerung 2,0 1,0 3,0 4,0 Wichtigkeit Zentraltaster „Alles-Aus“ Einzelraumregelung der Heizung vernetzte Rauchmelder Abschaltung der Heizung bei offenen Fenstern Rohrbruch- und Leckagerekennung/-alarmierung Fluchtwegsicherung im Brandfall präsenzgeregelte Heizung Gruppensteuerung der V erschattung Smartphone-Steuerung der Heizung Anwesenheitssimulation Gruppensteuerung der Beleuchtung Beleuchtung/V erschattung in Einbruchsfall Verschattung gesteuert dur ch Außenhelligkeit präsenzgesteuerte Beleuchtung Smartphone-Steuerung von allg. V erbrauchern Beleuchtungsszenen Netzfreischaltung automatische W ohnraumlüftung Smartphone-Steuerung der V erschattung Paniktaster 2,0 3,0 4,0 5,0 Wichtigkeit jb2015_gt.indb 148 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 149 der „Alles-Aus-Schalter“ etwas intelligenter sein und Verbraucher nur selektiv ausschalten. Manche müssen zeitlich versetzt ausge-schaltet werden (z. B. muss die Waschmaschine erst zu Ende waschen dürfen) und manche Verbraucher dürften gar nicht ausgeschaltet werden. Somit erfordert auch diese Funktion eine gewisse Intelli-genz, wie sie mit einem mechanischen Zentralschalter nicht möglich wäre. Die Funktion „zeitgesteuerte Rollläden“ hat erstaunlich schlecht abgeschnitten. Das erklärte sich über die Auswertung der persönli-chen Gespräche. An vielen Stellen antworteten die Personen mit „Na ja, solange ich das noch selber machen kann“ . Aus psychologischer Sicht war hier die Angst zu erkennen, zu viel abzugeben und somit als Mensch nicht mehr benötigt zu werden. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass man Senioren keine zeitgesteuerten Rollläden an-bieten sollte – nur sollte das nicht mit dem Argument erfolgen, dass das Arbeit abnimmt. Immerhin haben die zeitgesteuerten Rollläden auch einen Sicherheitsvorteil und energetischen Mehrwert, die man herausstellen kann und sollte. Für diese Zielgruppe hat Herr Mattausch im Rahmen seiner Arbeit auch die erwähnten Ausstattungspakete gebildet. Unter [3] sind mehr Details dazu zu lesen. Eine weitere Studie verfasste Sophie Sedlmeier [4]. Sie hat un- tersucht, wo es bereits Elektrik und Elektronik in Möbeln gibt und welchen Mehrwert eine Automation hätte. Als Beispiel sei hier die Beleuchtung innerhalb von Vitrinen genannt, da Lichtlösungen in Möbeln schon heute stark verbreitet sind. Nun wäre es aufwendig, bei Betreten oder Verlassen des Raumes jede einzelne Vitrine manuell schalten zu müssen. In Konsequenz werden Funktionen abgefragt, die Beleuchtung mit der Raumautomation zu koppeln (z. B. Zentral-taster oder präsenz-/tageslichtgeführte Beleuchtungsregelung). Die Bewertung der Funktionen ist in Bild 4 dargestellt. Ja, aber … Theoretisch kommen bei einem gut beratenen Kunden keine Zwei-fel an einer Beauftragung auf. Im wahren Leben ist das aber anders. Entweder fühlt sich der Kunde doch nicht so gut beraten, wie Sie es denken. Zum anderen ist es normal, dass Menschen vor einer kon- jb2015_gt.indb 149 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 150 zentraler Ein-/Ausschalter 2,0 1,0 3,0 4,0 Abneigung von Metall im Bettbereich tageslichtabhängige Regelung (Küchenleuchten) präsenzgesteuerte Beleuchtung integrierte Audio-Anlage in der Küche höhenverstellbare Oberschränke Abneigung von "Elektrosmog" im Schlafzimmer Weckvorgang über zunehmendes Licht/Musik Orientierungsbeleuchtung am Bett Einklemmschutz an motorischen Türen/Schubladen Kollissionsschutz Schranktüren/Schubladen elektrische T ischverlängerung höhenverstellbare Schubladen elektrisch verstellbarer Lattenrost motorisches Öffnen von Schubladen/Türen Touchpanel in der Küche Beleuchtungssteuerung über Smartphone positionsabhängige Beleuchtung integrierte Musikanlage im Bett integrierter Fernseher in der Küche Wichtigkeit „Alles-Aus“-Schalter Videokamera Eingangstür diverse Notrufknöpfe Alarmanlage mit automatischem Notruf Verbrauchsanzeige Anwesenheitssimulation Überprüfung der Sensorik beim V erlassen der W ohnung Armband mit Vitaldatenüber wachung Einzelraumregelung Heizung Heizungsregelung beim V erlassen oder Öffnen von Fenstern automatische W ohnraumlüftung intelligenter Medikamentenschrank Videokomunikationssystem mit Betreuung automatisches Licht T oilettengang Chipsystem Eingangstür Touchscreen Fernbedienung für Alles automatische Fenster Infosystem über Fernseher höhenverstellbare Schränke Lichtszenarien zeitgesteuerte Rollläden automatische Gartenbewässerung Sprachsteuerung PC-Steuerung 2,0 1,0 3,0 4,0 Wichtigkeit Zentraltaster „Alles-Aus“ Einzelraumregelung der Heizung vernetzte Rauchmelder Abschaltung der Heizung bei offenen Fenstern Rohrbruch- und Leckagerekennung/-alarmierung Fluchtwegsicherung im Brandfall präsenzgeregelte Heizung Gruppensteuerung der V erschattung Smartphone-Steuerung der Heizung Anwesenheitssimulation Gruppensteuerung der Beleuchtung Beleuchtung/V erschattung in Einbruchsfall Verschattung gesteuert dur ch Außenhelligkeit präsenzgesteuerte Beleuchtung Smartphone-Steuerung von allg. V erbrauchern Beleuchtungsszenen Netzfreischaltung automatische W ohnraumlüftung Smartphone-Steuerung der V erschattung Paniktaster 2,0 3,0 4,0 5,0 Wichtigkeit Bild 4: Bewer tung der Funktionen „Elektrifizierung von Möbeln“ [4] jb2015_gt.indb 150 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 151 kreten Entscheidung von Zweifeln geplagt werden. Dann kommt es zu den berühmten „Ja, aber …“, auf die entsprechend eingegangen werden sollte. In der Tabelle 1 sind die wesentlichen möglichen Bedenken von Kunden und ein Tipp zum Umgang damit aufgeführt. Leitfaden zur weiteren Umsetzung Mit der Ermittlung der sinnvollen Funktionen ist ein erster wichtiger Schritt getan. Wie geht es aber weiter? Neben den Funktionen aus Nutzersicht sollten auch noch Funktionen zum effizienten Betrieb der TGA (technische Gebäudeausrüstung) betrachtet werden. Dies kann durch den Fachbetrieb erfolgen, der zur weiteren Umsetzung einge- Ja aber ... Gilt nicht, wenn … Tipp/Hinweis ... das brauche ich nicht. (Zweifel des Kunden am Nutzen) … sinnvolle und einfache Funktionen festgelegt werden. Kundenanalyse und -befragung ... das ist nicht bedienbar. (Zwei-fel des Kunden. an der Bedie-nung) … die Anforderungen an die Be-dienung vorher festgelegt werden (auch z. B. Prioritäten zwischen manueller/automatischer Bedie-nung). Anforderungen festlegen ... das ist zu teuer! (Zweifel des Kunden bezüglich der Kosten) … die passende Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall (zentral/dezentral, mit/ohne Feld-bussysteme) ausgewählt wird Neutrale Beratung nutzen; Vergleichsangebote über un-terschiedliche Technologien anfordern (Vorgaben z. B. gemäß „Beratungs- und Planungs-leitfaden“) [5] … Energieeinsparungen genutzt werden EN 15232/Tool „Gebäude-IQ“ [6] … Individuallösungen vermieden werden. Ausstattungspakete bilden ... im Fehlerfall habe ich ein Pro-blem. (Angst des Kunden vor dem Kontrollverlust) … Individuallösungen vermieden werden. Ausstattungspakete bilden Tabelle 1: Mögliche Bedenken von Kunden sowie Tipps zur Behandlung jb2015_gt.indb 151 18.08.2014 13:19:22 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 152 schaltet werden sollte. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist aber auch in dem kostenlosen Leitfaden „Beratungs- und Planungsprozess“ dokumentiert. Dieser Leitfaden beschreibt eine Vorgehensweise, die mit einer für den Nutzer verständlichen Beratung beginnt und dann in einen strukturierten und nachvollziehbaren Prozess übergeht. Zu-sätzlich zum eigentlichen Leitfaden sind Vorlagen (Excel- und Power-Point) kostenlos zu beziehen, um die Übertragung der Vorgehenswei-se auf eigene Projekte zu erleichtern. Weitere Details dazu sind unter [5] nachzulesen. Weitere Informationen/Literatur [1] www.IntegraleEnergieeffizienz.de/projekte/ zielgruppenanalyse/smarthome/ [2] Mattausch, K.: Einsatz von Gebäudeautomation zur Unter- stützung für altersgerechtes Wohnen, 2011 [3] www.IntegraleEnergieeffizienz.de/projekte/ zielgruppenanalyse/aal/ [4] Sedlmeier, S.: Erstellung einer Marktanalyse und Formulierung der Zukunftsperspektive zur Elektrifizierung und Technisierung von Möbeln für einen mittelständischen Massivholzhersteller, 2012 [5] www.IntegraleEnergieeffizienz.de/projekte/automation2go/ bpl/ [6] www.gebaeude-iq.de jb2015_gt.indb 152 18.08.2014 13:19:23 Uhr