Warenkorb
0 Punkte
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
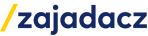
Unbekannt
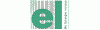
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
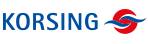
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
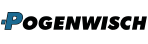
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
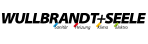
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

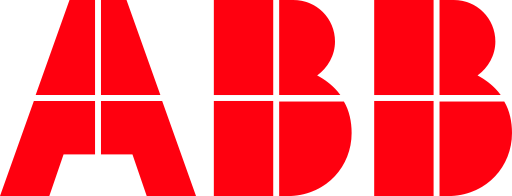
Praxiswissen Konstantlichtregelung
Praxiswissen ABB i-bus ® KNX Beleuchtung Konstantlichtregelung
Dieses Handbuch gibt Tipps und Tricks zum Praxiswissen der Konstant- lichtregelung. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Haftungsausschluss: Trotz Überprüfung des Inhalts dieser Druckschrift auf Übereinstimmung mit der Hard- und Software können Abweichungen nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir hierfür keine Gewähr übernehmen. Notwendige Korrekturen fließen in neue Versionen des Handbuchs ein. Bitte teilen Sie uns Verbesserungsvorschläge mit.
1 Inhaltsverzeichnis Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Wie funktioniert die Konstantlichtregelung? ..................................................................................... 2 Was ist der Unterschied zwischen Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte? ....................................... 3 Wovon hängt die vom Lichtfühler erfasste Leuchtdichte bzw. der Messwert des Lichtfühlers ab? ..... 5 Wovon hängt die vom Luxmeter erfasste Beleuchtungsstärke ab? ................................................... 8 Unterschied Lichtfühler – Luxmeter ................................................................................................. 10 Welche Probleme entstehen durch die direkte Messung der Beleuchtungsstärke für die Sollwerteinstellung und die indirekte Messung der Leuchtdichte für die Lichtregelung? ................... 11 Der Einfl uss der spektralen Verteilung .............................................................................................. 11 Der Einfallswinkel des Lichtes auf Lichtfühler und Luxmeter ............................................................ 12 Die Refl exionseigenschaften des Raumes im Erfassungsbereich ...................................................... 14 Auswahl des Lichtfühlerstabes......................................................................................................... 14 Platzierung des Lichtfühlers ............................................................................................................. 16
2 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Die folgende Ausarbeitung zum Thema Konstantlichtregelung soll ausreichende Hintergrund- informationen geben, – um die Wirkungsweise einer Konstantlichtregelung besser zu verstehen, – um den für die Erfassung des Istwertes notwendigen Lichtfühler optimal platzieren zu können, – um kritische Umgebungsbedingungen, welche die Funktion der Konstantlichtregelung negativ beeinfl ussen können, zu erkennen und – um die durch die Physik gesetzten Grenzen der Konstantlichtregelung beurteilen zu können. Dazu ist es auch notwendig, sich mit den wichtigsten Begriffen der Lichttechnik zu befassen. Wie funktioniert die Konstantlichtregelung? Bei der Konstantlichtregelung misst ein an der Decke montierter Lichtfühler die Leuchtdichte der Flächen in seinem Erfassungsbereich, z. B. des Bodens oder der Schreibtische. Diesen Messwert (Istwert) vergleicht er mit dem vorgegebenen Sollwert und führt die Stellgröße so nach, dass die Abweichung zwischen Soll- und Istwert minimal wird. Wird es draußen heller, dann wird der Anteil des Kunstlichtes reduziert. Wird es draußen dunkler, wird der Anteil des Kunstlichtes erhöht. Die genaue Funktion des Lichtreglers selbst ist in dem Handbuch des Licht- reglers LR/Sx.16.1 im Detail beschrieben. Bei der Einstellung des Sollwertes wird ein Luxmeter verwendet, das unterhalb des Lichtfühlers zu platzieren ist, z. B. auf einem Schreibtisch. Dieses Luxmeter erfasst die Beleuchtungsstärke, mit der die Flächen unterhalb des Lichtfühlers beleuchtet werden. Sollwert Regler LR/S x.16.1 Lichtfühler LF/U 2.1 Istwert = Sensorwert Helligkeitswert Kunstlichtanteil Stellgröße 1 – 10 V Erfasster Helligkeitswert + + + Absorptions- und Reflexions- eigenschaften des Raumes Helligkeitswert Tageslichtanteil
3 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Das Ziel einer Konstantlichtregelung ist, die beim Setzen des Sollwertes eingestellte Beleuch- tungsstärke konstant zu halten. Um das perfekt realisieren zu können, müsste der Lichtfühler genau an der Stelle platziert werden, an der das Luxmeter zur Einstellung des Sollwertes platziert war, um ebenfalls dort die Beleuchtungsstärke zu erfassen. Da dies jedoch aus prak- tischen Gründen nicht möglich ist, wird der Lichtfühler üblicherweise an der Decke montiert. Dies ist ein Kompromiss. Denn zur Referenz-Einstellung des Sollwertes wird zwar zur Messung der Beleuchtungsstärke ein Luxmeter verwendet, der Lichtregler hingegen erfasst primär die Leuchtdichte unterhalb des Lichtfühlers. Dadurch hält der Lichtregler indirekt die Beleuch- tungsstärke konstant. Wenn bei dieser indirekten Messung bestimmte Randbedingungen nicht beachtet werden, kann es dazu führen, dass eine Konstantlichtregelung überhaupt nicht oder nur unzureichend funktioniert. Das ist kein spezifi sches Problem unserer Konstantlichtregelung, sondern betrifft alle Konstant- lichtregelungen. Was ist der Unterschied zwischen Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte? Um die mit der indirekten Messung verbundene Problematik zu verstehen, ist es notwendig, sich mit den wichtigsten Begriffen der Lichttechnik auseinander zu setzen. Es werden nur die Grundbegriffe erklärt und dabei auf die genaue Erklärung bzw. mathematische Herleitung komplexerer Begriffe, z. B. Lichtstärke = Lichtstrom/Steradiant, verzichtet. Ein Leuchtmittel, z. B. eine Leuchtstoffröhre, wandelt elektrische Energie in Licht um. Die von einer Lichtquelle ausgehende Strahlung wird als Lichtstrom bezeichnet. Die Einheit ist das Lumen [lm]. Leuchtmittel wandeln die zugeführte elektrische Leistung mit unterschiedlichem Wirkungsgrad in Licht um. Kategorie Typ Gesamtlicht- ausbeute (lm/W) Gesamtlicht- ausbeute Glühlampe 5-W-Glühlampe 5 0,7 % 40-W-Glühlampe 12 1,7 % 100-W-Glühlampe 15 2,1 % Glas-Halogen 16 2,3 % Quarz-Halogen 24 3,5 % Hochtemperatur-Glühlampe 35 5,1 % Leuchtstoffl ampe 5 – 26 W Energiesparlampe 45 – 70 6,6 – 10,3 % 26 – 70 W Energiesparlampe 70 – 75 10,3 – 11,0 % Leuchtstoffröhre, mit induktivem Vorschaltgerät 60 – 90 7 % Leuchtstoffröhre, mit elektronischem Vorschaltgerät 80 – 110 11 – 16 % Leuchtdiode effi zienteste weiße LEDs am Markt 35 – 100 5 – 15 % weiße LED (Prototyp, in Entwicklung) bis 150 bis 22 % Bogenlampe Xenon-Bogenlampe typ. 30 – 50; bis 150 4,4 – 7,3 %; bis 22 % Quecksilber-Xenon-Bogenlampe 50 – 55 7,3 – 8,0 % Hochdruck-Quecksilberdampfl ampe (z. B. HQL-Brenner) 36 (50W HQL) – 60 (400W HQL) bis 8,8 %
4 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Kategorie Typ Gesamtlicht- ausbeute (lm/W) Gesamtlicht- ausbeute Gasentladungs- lampe Halogenmetalldampfl ampe (z. B. HCI-Brenner) 93 (70W HCI) – 104 (250W HCI) bis 15 % Natriumhochdrucklampe 150 22 % Natriumniederdrucklampe 200 29 % 1400-W-Schwefellampe 95 14 % Theoretisches Maximum 683 100 % Quelle: Wikipedia Neben dem Lichtstrom gibt es den Begriff Lichtstärke, sie wird auch als Lichtstromdichte bezeichnet. Die Lichtstärke wird in Candela [cd] gemessen. Candela ist die Maßeinheit für die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung (Raumwinkel) abgestrahlte Lichtstärke. Eine genauere Defi nition der Lichtstärke führt zu sehr in die Mathematik, z. B. die Erklärung von Steradiant. Vereinfacht gilt: Eine Lichtstärke von 1cd liegt vor, wenn 1m entfernt von der Lichtquelle die Beleuchtungsstärke 1 lx gemessen wird. Der von einer Lichtquelle ausgehende Lichtstrom beleuchtet die Flächen, auf die er auftritt. Die Intensität, mit der die Flächen beleuchtet werden, wird als Beleuchtungsstärke bezeichnet. Die Beleuchtungsstärke hängt von der Größe des Lichtstroms und der Größe der Flächen ab. Sie ist wie folgt defi niert: E = Φ/ A [lx=lm/m 2 ] E = Beleuchtungsstärke Φ = Lichtstrom in lm A = beleuchtete Fläche I Ω Lichtstärke I = Lichtstromdichte/Lichtstärke Ω = Raumwinkel
5 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Gemäß der obigen Tabelle erzeugt eine 100-W-Glühlampe mit 15 lm/W maximal einen Licht- strom von 1500 lm. Würde der gesamte Lichtstrom der Glühlampe nicht kugelschalenartig in den Raum abgestrahlt, sondern gebündelt und gleichmäßig verteilt auf einer Fläche von 1 m 2 auftreffen, dann wäre der Wert der Beleuchtungsstärke auf jedem Punkt dieser Fläche 1500 lx. Die empfundene Helligkeit einer beleuchteten Fläche hängt von der Beleuchtungsstärke und dem Refl exionsgrad der beleuchteten Fläche ab. Der Refl exionsgrad ist der von einer beleuch teten Fläche refl ektierte Teil des auf sie fallenden Lichtstroms. Typische Werte für den Refl exions grad sind: 90 % blank poliertes Silber 75 % weißes Papier 65 % blank poliertes Aluminium 20 – 30 % Holz 5 % schwarzer Samt Die Einheit, mit der angegeben wird, wie hell eine beleuchtete oder auch eine selbst leuchtende Fläche (z.B. LCD-Bildschirm) empfunden wird, ist die Leuchtdichte. Die Einheit der Leuchtdichte ist cd/m 2 . Wenn z. B. weißes Papier einer Beleuchtungsstärke von 500 lx ausgesetzt ist, dann beträgt die Leuchtdichte etwa 130 – 150 cd/m 2 . Bei der gleichen Beleuchtungsstärke hat ein Umwelt- schutzpapier nur eine Leuchtdichte von 90 – 100 cd/m 2 . Wovon hängt die vom Lichtfühler erfasste Leuchtdichte bzw. der Messwert des Lichtfühlers ab? Die vom Lichtfühler „primär“ erfasste Leuchtdichte hängt von verschiedenen Kriterien ab. Sie ist abhängig von der Beleuchtungsstärke, mit der die Flächen im Erfassungsbereich des Lichtfühlers bestrahlt werden. Je höher die Beleuchtungsstärke, desto höher auch die Leucht- dichte der bestrahlten Flächen. Dasselbe gilt für den Refl exionsgrad der Flächen. Je höher der Refl exionsgrad, desto höher die Leuchtdichte der Flächen und somit auch der Messwert des Sensors. Der Messwert des Sensors ist der für die Lichtregelung verwendete Istwert. Ebenfalls spielt die Montagehöhe des Sensors eine Rolle. Wäre der Lichtfühler ein ideales „Leuchtdichte-Messgerät“, dann wäre die von ihm gemessene Leuchtdichte unabhängig von der Montagehöhe des Lichtfühlers. Da dies nicht der Fall ist, nimmt der Messwert des Licht- fühlers mit zunehmender Montagehöhe ab. Ein weiteres Kriterium für den Messwert des Lichtfühlers ist dessen Richtcharakteristik. Der Lichtfühler erfasst primär die Leuchtdichte der sich unter ihm befi ndenden Flächen.
6 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Wie aus dem obigen Bild ersichtlich ist, liegt der 3-dB-Öffnungswinkel des bisher verfügbaren Lichtfühlers LF/U 1.1 bei etwa 60°. Ein Beispiel: Bei einer Montagehöhe von drei Metern liegt der Durchmesser des Erfassungs- bereiches unterhalb des Lichtfühlers bei etwas mehr als fünf Metern. Die Leuchtdichte aller beleuchteten oder selbst leuchtenden Flächen innerhalb dieses Kreises wird vom Lichtfühler erfasst. Eng zusammen mit der Richtcharakteristik hängen die räumlichen Gegebenheiten. Hier haben sich in der Praxis insbesondere stark refl ektierende Fensterbänke oder auch Wände negativ bemerkbar gemacht. In diesem Bild sieht man deutlich die stark refl ektierenden weißen Fensterbänke im Erfassungs- bereich des Lichtfühlers, der nur etwa zwei Meter von den Fenstern entfernt montiert ist. 20% 40% 60% 80% 100% -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° -5° 0° 5° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° Typ A Decke
7 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Auch Refl exionen von Schränken oder Glasplatten, die sich wie in dem folgenden Bild in unmittel barer Nachbarschaft des Lichtfühlers befi nden, werden vom Lichtfühler erfasst. Die Refl exionen können sowohl von den vertikalen Flächen (Türen) als auch z. B. von der Ober- seite von Schränken kommen. Ebenso können direkt von der Sonne angestrahlte Beschattungen, z. B. Jalousien oder Be hänge, den Lichtfühler beeinfl ussen, wenn sie sich in seinem Erfassungsbereich befi nden.
8 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Insbesondere in der Nähe von Fenstern wird die Decke durch das Tageslicht wesentlich stärker bestrahlt als das in der Tiefe des Raumes der Fall ist. Je nach Abstand des Lichtfühlers vom Fenster, kann das seitlich auf den Lichtfühler fallende Licht den eigentlichen Messwert des Lichtfühlers, der sich aus der Beleuchtungsdichte in seinem Erfassungsbereich ergibt, stark verfälschen. Der Lichtfühler hat zwar eine ausgeprägte Richtcharakteristik. Wenn aber die Beleuchtungsstärke des seitlich auf ihn fallenden Lichts um Faktoren höher ist als die Leuchtdichte in seinem Erfassungsbereich, dann ist diese Richt- charakteristik nicht mehr ausreichend. Wovon hängt die vom Luxmeter erfasste Beleuchtungsstärke ab? Luxmeter erfassen die Beleuchtungsstärke am Messort und haben eine sogenannte horizontale Rundstrahlcharakteristik, d.h., sie bewerten den aus allen horizontalen Richtungen am Messort einfallenden Lichtstrom auf die gleiche Weise. Unterschiedlich bewertet wird hingegen der Lichtstrom beim vertikalen Einfallswinkel. Senkrecht von oben auf das Luxmeter einfallendes Licht wird wesentlich stärker bewertet als seitlich einfallendes Licht. Der Fachbegriff hierzu ist Cosinus-Korrektur. Gleichzeitig wird die spektrale Verteilung im Bereich von 380 nm bis 780 nm entsprechend der Empfi ndlichkeit des menschlichen Auges bewertet. Leider ergeben sich in der Praxis bei Messungen mit unterschiedlichen Messgeräten am selben Messort unter denselben Messbedingungen stark unterschiedliche Messwerte.
9 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung In dem obigen Bild zeigt das linke Messgeräte 948 lx, das mittlere (gelb) 765 lx und das rechte Messgerät 827 lx an. Die Unterschiede können dabei – abhängig davon, ob es sich um Tages- licht, Kunstlicht oder Mischlicht handelt oder ob sich die Geräte im Schattenbereich befi nden oder direkt von der Sonne bestrahlt werden – größer oder kleiner sein. Am gleichen Messort zeigen, bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen durch das einfallende Tageslicht mit leichter Schattenbildung, beide Geräte im linken Bild deutlich unter- schiedlichere Werte und im rechten Bild nahezu den gleichen Wert an. Daher ist es wichtig bei späteren Überprüfungen der Lichtregelung dasselbe Messgerät (Luxmeter) wie bei der Einreglung zu verwenden. Nur so sind vergleichbare Ergebnisse zu bekommen.
10 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Unterschied Lichtfühler – Luxmeter Während der Lichtfühler, das von den Flächen in seinem Erfassungsbereich refl ektierte Licht er- fasst, erfasst das Luxmeter, das von den Leuchten abgestrahlte Kunstlicht und/oder das durch die Fenster einfallende direkte Sonnenlicht bzw. bei bewölktem Himmel das diffuse Tageslicht. Das wird in der untenstehenden Zeichnung nochmals verdeutlicht. A Beleuchtungsstärke φ A Leuchtdichte Auge bzw. Lichtfühler Ͱ = Sehwinkel
11 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Welche Probleme entstehen durch die direkte Messung der Beleuchtungs- stärke für die Sollwerteinstellung und die indirekte Messung der Leucht- dichte für die Lichtregelung? Unter der Voraussetzung, dass – sich die spektrale Verteilung des Lichtes nicht ändert, – der Einfallswinkel des Lichtes auf Lichtfühler und Luxmeter sich nicht ändert – die Refl exionseigenschaften des Raumes im Erfassungsbereich des Lichtfühlers und des Luxmeters sich nicht ändern besteht ein weitgehend linearer Zusammenhang zwischen dem Messwert des Lichtfühlers und der Beleuchtungsstärke, d.h., proportional zur Änderung der Beleuchtungsstärke ändert sich der Messwert des Lichtfühlers. Damit ist es prinzipiell möglich, für die Lichtregelung der Beleuchtungsstärke als Istwert indirekt die Leuchtdichte zu erfassen. Der Einfl uss der spektralen Verteilung Da bei einer Konstantlichtregelung sich im Laufe eines Tages das Mischungsverhältnis von Kunst- und Tageslicht und damit die spektrale Verteilung des Lichtes ändert, können bei konstant gehaltener Beleuchtungsstärke am Messort des Lichtfühlers unterschiedliche Mess- werte entstehen. Das hat im Umkehrschluss zur Konsequenz, dass bei konstanten Messwerten am Lichtfühler (dies wird durch die Lichtregelung erreicht) sich unterschiedliche Beleuchtungs- stärken ergeben. Um das zu vermeiden, muss der unterschiedliche Einfl uss von Tageslicht und Kunstlicht auf den Lichtfühler kompensiert werden. Dies geschieht bei den neuen Lichtreglern LR/Sx.16.1 durch einen Abgleich bei Kunstlicht und bei Tageslicht. Dazu wird zunächst bei reinem Kunstlicht der Sollwert eingestellt. Der Lichtregler speichert dabei den dazu gehörenden Istwert des Fühlers als Sollwert und die dazugehörende Stellgröße für die Ansteuerung des Kunstlichtes. Danach fährt der Lichtregler die Stellgröße von 0…100 % durch und speichert ebenfalls die dazugehörenden Istwerte. Damit weiß der Lichtregler, welcher Istwert welcher Stellgröße bei reinem Kunstlicht entspricht. Anschließend wird der Tageslichtabgleich durchgeführt. Dazu wird bei Tageslicht und ohne Zugabe von Kunstlicht der Sollwert eingestellt. Damit weiß der Lichtregler, welcher Istwert dem Sollwert bei reinem Tageslicht entspricht. Aus den bei beiden Abgleichen ermittelten Werten errechnet der Regler die Korrekturfaktoren, die bei den unterschiedlichsten Mischungsverhältnissen von Tages- und Kunstlicht erforder- lich sind, um trotz indirekter Erfassung der Leuchtdichte die Beleuchtungsstärke konstant zu halten.
12 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Der Einfallswinkel des Lichtes auf Lichtfühler und Luxmeter Wenn der Tageslichtabgleich bei diffusem Tageslicht, z. B. bewölktem Himmel, durchgeführt wird, stellt sich bei einem vorgegebenen Luxwert für die Beleuchtungsstärke beim Lichtfühler ein bestimmter Wert ein. Wird der Tageslichtabgleich bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt, ist es möglich, dass sich – bei dem gleichen vorgegebenen Luxwert für die Beleuchtungsstärke – beim Lichtfühler ein davon deutlich abweichender Luxwert einstellt. Gründe dafür sind z. B., dass durch den unterschiedlichen Einfallswinkel des Lichtes Licht - fühler und Luxmeter unterschiedlich beeinfl usst werden oder dass Refl exionen an hellen oder spiegelnden Flächen auftreten, die zwar den Lichtfühler aber nicht das Luxmeter beeinfl ussen. Die beste Lösung in solchen Fällen ist es, den Lichtfühler so zu versetzen, dass er bei den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen auf die gleiche Art und Weise beeinfl usst wird wie das Luxmeter. Üblicherweise geschieht dies durch Betrachten der Flächen unterhalb des Licht- fühlers und am Lichtfühler selbst bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Eine in der Praxis üblicherweise aus Zeitgründen nicht durchführbare Methode ist, die optimale Position des Lichtfühlers durch Versuche zu ermitteln. Ein Beispiel: In einem nichtrepräsentativen Raum im Souterrain eines Gebäudes wurde an verschiedenen Positionen im Raum (in Teilungseinheiten der Decke (TE) angegebener Abstand zum Fenster) morgens und nachmittags mit einem Luxmeter an der Decke (rot) und auf Schreibtischhöhe (blau) die Beleuchtungsstärke und der Quotient Beleuchtungsstärke Boden/Decke ermittelt.
13 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Wie aus den Diagrammen zu sehen ist, liegt am Morgen (keine direkte Sonneneinstrahlung in den Raum) der Quotient im Bereich zwischen 2,7 und 4,2, am Nachmittag hingegen (direkte Sonneneinstrahlung in den Raum) zwischen 0,9 und 6,6. Dies bedeutet, in einer Entfernung von 3,5 Teilungseinheiten vom Fenster zeigt, unabhängig von der Art der Beleuchtung, ein Luxmeter an der Decke immer einen 3,75 x höheren Wert an als am Boden. An anderen Orten zeigen die beiden Luxmeter, abhängig von der Art der Beleuchtung, Werte an, die sich um einen mehr oder weniger großen Faktor unterscheiden. Aus Gründen der vereinfachten Handhabung wurden die Messungen mit zwei Luxmetern durchgeführt. Wollte man auf diese Art und Weise die optimale Position des Lichtfühlers ermitteln, dann müsste man die gleichen Messungen mit einem Luxmeter in Schreibtischhöhe und mit einem Lichtfühler an der Decke durchführen. Durch die vereinfachte Messung mit zwei Luxmetern ist aber schon qualitativ erkennbar, worauf bei der Positionierung des Lichtfühlers zu achten ist. Man muss die Position fi nden, bei der das Luxmeter und der Lichtfühler bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen auf gleiche Art und Weise beeinfl usst werden. In der Praxis hat sich bisher gezeigt, dass in den meisten Fällen die optimale Position des Lichtfühlers im Bereich von Raummitte bis zum hinteren Drittel des Raumes, auf der von den Fenstern abgewandten Seite, liegt. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 7 8 Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 1 2 3 4 5 6 7 8 Reihe 1 Reihe 1 Reihe 1 Reihe 2 Messung am Morgen Messung am Nachmittag
14 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Die Refl exionseigenschaften des Raumes im Erfassungsbereich Wie schon Eingangs erwähnt, hängt die Leuchtdichte einer Fläche von der Beleuchtungsstärke und den Refl exionseigenschaften dieser Fläche ab. Bei einem dunklen Teppichboden liegt der Refl exionsfaktor im Bereich von 5 – 10 %, während er bei einem Holzboden bei etwa 20 – 30 % liegt. Befi ndet sich unterhalb des Lichtfühlers ein hellgrauer Schreibtisch, so liegt dessen Refl exionsfaktor bei etwa 50 %. Daraus ist ersichtlich, dass es keinen Sinn macht, eine Konstantlichtregelung einzustellen, wenn der Raum noch nicht richtig eingerichtet ist. Wird z. B. der Sollwert eingestellt, wenn sich noch keine Möbel sondern nur dunkler Teppich- boden im Raum befi nden, dann wird, nach der endgültigen Möblierung des Raumes mit hellen Möbeln, der sich einstellende Istwert deutlich höher liegen als der ursprünglich eingestellte Sollwert. Auch im Laufe des Betriebs durchgeführte Änderungen/Umstellungen der Möblierung, das Versetzen von Stellwänden, andere Wandfarben usw. können eine erneute Einstellung des Sollwertes und ggf. auch ein Versetzen des Lichtfühlers erforderlich machen. Auswahl des Lichtfühlerstabes Der Lichtfühler LF/U2.1 besitzt in Verbindung mit dem bis Mitte 2008 verfügbaren klaren Licht- fühlerstab einen 3-dB-Öffnungswinkel von etwa 120 °, d.h., er erfasst die Leuchtdichte einer relativ großen Fläche unterhalb seines Montageortes. Unterhalb eines Winkels von etwa 70 ° wird seitlich auf den Lichtfühler fallendes Licht kaum ge- dämpft. Licht, das im Winkelbereich von 85 – 90 ° auf ihn fällt, wird jedoch sehr stark gedämpft (Totalrefl ektion am Glasstab). klarer Stab 0% 20% 40% 60% 80% 100% -180° -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
15 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Im praktischen Einsatz hat sich gezeigt, dass bei kritischen Umgebungsbedingungen ein Umhüllen des Stabes erforderlich sein könnte, um den Einfl uss von seitlich einfallendem Licht soweit wie möglich zu unterdrücken. Aus diesem Grunde ist seit Mitte 2008 ein grau lackierter oder mit Schrumpfschlauch über- zogener Stab verfügbar, der einen deutlich kleineren Öffnungswinkel von etwa 40 ° hat. Bei Verwendung einer dieser Stäbe werden Beeinfl ussungen durch seitlich einfallendes Licht deutlich reduziert. Weiterhin ist die Regelung empfi ndlicher auf Veränderungen im Erfassungs- bereich des Lichtfühlers, z. B. das Auswechseln einer dunklen Schreibtischaufl age durch eine helle. 0% 20% 40% 60% 80% 100% -180° -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° Doppelter Schrumpfschlauch
16 Praxiswissen zur Konstantlichtregelung Sollte in extrem kritischen Fällen der Einsatz des beschichteten Stabes nicht ausreichend sein, dann kann – wie früher in solchen Fällen üblich – der Stab z. B. mit dem Mantel einer NYM- Leitung umhüllt werden. Damit ergeben sich dann ähnliche Verhältnisse wie bei der hier darge- stellten Verwendung eines schwarzen Rohres. Platzierung des Lichtfühlers Für die Platzierung des Lichtfühlers ist in Ergänzung zu den Hinweisen im Handbuch folgendes zu beachten: Die optimale Platzierung des Lichtfühlers ist nur in einem fertig eingerichteten Raum möglich. Da dies üblicherweise nicht möglich ist, kann, wenn bereits im Planungsstadium nur auf Basis von Zeichnungsunterlagen die Position des Lichtfühlers festgelegt werden muss, wie folgt vorgegangen werden: Als Montageort für den Lichtfühler ist vorzugsweise der Bereich von Raummitte bis zum hin- teren Drittel des Raumes, auf der von den Fenstern abgewandten Seite, vorzusehen. Falls aus den Zeichnungen schon ersichtlich, muss darauf geachtet werden, dass der Licht- fühler nicht von Leuchten direkt angestrahlt werden kann, z. B. von Uplights oder unmittelbar benachbarten Leuchten. Der Abstand zu seitlich vom Lichtfühler angebrachten Leuchten ist zu maximieren. 0% 20% 40% 60% 80% 100% -180° -90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -15° -10° 5° 10° 15° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° schwarzes Rohr -5° 0°
Druck Nr . 2CDC 507 093 M0101 ABB STOTZ-KON TAKT GmbH Postfach 10 16 80, 69006 Hei del berg Eppelh eimer Straße 82, 69123 Hei del berg Telefon (0 62 21) 7 01-6 07 [email protected] www.abb.de/knx www.abb.de/stotz-kontakt Die Anga ben in die ser Druck schrift gel ten vor behalt lich tech nischer Ände run gen KNX Tech nische Helpline: (0 62 21) 7 01- 4 34 [email protected] Sicherheitstechnik Tech nische Help line: (0 62 21) 7 01- 7 82 [email protected]