Warenkorb
0 Punkte
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
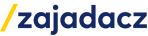
Unbekannt
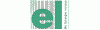
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
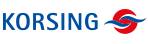
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
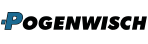
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
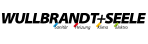
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt


Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht aufbauen
Arbeitspapier Ladeinfrastruktur und Netzintegration der Nationale Plattform Elektromobilität (NPE), Juni 2012.
Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht aufbauen Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) AG 3 – Ladeinfrastruktur und Netzintegration Arbeitspapier, Juni 2012
Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 1 Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht aufbauen Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)AG 3 - Ladeinfrastruktur und Netzintegration Mögliche Lösungsansätze für die Ladeinfrastruktur Das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2020 wird durch die bedarfs-gerechte Bereitstellung von Ladeinfrastruktur unterstützt. Die Ladeinfrastruktur muss synchron zum Fahrzeughochlauf aufgebaut und volkswirtschaftlich zu den geringstmögli-chen Kosten bereitgestellt werden. Zur Überwindung der Reichweitenunsicherheit wird ein im Verhältnis zur Normalladeinfrastruktur geringeres Angebot an Schnellladeinfra-struktur als notwendig angesehen. Die Schnellladeinfrastruktur ist essenziell, um Bedenken potenzieller Kunden bezüglich der Reichweite und der ständigen Verfügbar-keit einer Lademöglichkeit auszuräumen. Um die Hochlaufkurven für Fahrzeuge zu erreichen, sollten zudem auch Nutzer ohne private Stellplätze eine bei Bedarf verfügbare Lademöglichkeit haben. Für Carsharing-Konzepte mit Elektrofahrzeugen ist Ladeinfra-struktur im öffentlich zugänglichen Raum zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzepts. Grundsätzlich lassen sich folgende drei Kategorien von Ladeinfrastruktur unter-scheiden: • (1) „Normalladen 1 im privaten Raum“: Dazu zählen Ladepunkte im privaten bezie- hungsweise gewerblichen Raum (Steckdose mit Absicherung und Zuleitung, Wallbox-Ladepunkt auf dem Firmengelände und im öffentlich zugänglichen Bereich). • (2) „Normalladen im öffentlichen Raum“: Dazu zählen Ladepunkte im rein öffentlichen Raum (Ladesäule am Straßenrand, innerorts). • (3) „Schnellladen 2 “: Dazu zählen Schnellladestationen an öffentlich zugänglichen und viel befahrenen Orten. Ausgangssituation Bisher hat die Energiewirtschaft in Deutschland mehr als 2.200 öffentlich zugängliche, also öffentliche und halböffentliche, Ladepunkte aufgebaut. Davon befinden sich über 1.000 Ladepunkte im rein öffentlichen Raum. Schnellladen wird derzeit an zwölf Stationen entlang der Autobahnen und in Städten angeboten. Im privaten Bereich zeigen zudem Erfahrungen aus den Modellregionen und -projekten, dass in der Regel jedes Elektrofahrzeug mit einem privaten Ladepunkt zu Hause oder am Arbeitsplatz ausgestattet wird. Bei aktuell rund 4.500 Elektrofahrzeugen in Deutsch-land existieren schätzungsweise auch etwa genauso viele private Ladepunkte.Zum 1. Januar diesen Jahres wiesen bereits 18 Städte in Deutschland mehr als zehn öffentlich zugängliche Ladestationen (in der Regel mit je zwei Ladepunkten) auf, siehe Tabelle. In 390 deutschen Städten wird mindestens eine Ladestation betrieben.Von den öffentlich zugänglichen Ladestationen verfügen ca. 60 % über eine maximale Leistung von 11 bis 22 kW. Der mit 55 % am häufigsten verwendete Anschluss ist Wechselstrom (AC) 3-phasig. 1 Normalladen umfasst Ladeleistungen bis 44 Kilowatt. 2 Ladeleistungen von bis zu 100 Kilowatt in Untersuchung, siehe Kapitel 4.1.5 IKT.
Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 1 Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht aufbauen Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)AG 3 - Ladeinfrastruktur und Netzintegration Mögliche Lösungsansätze für die Ladeinfrastruktur Das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2020 wird durch die bedarfs-gerechte Bereitstellung von Ladeinfrastruktur unterstützt. Die Ladeinfrastruktur muss synchron zum Fahrzeughochlauf aufgebaut und volkswirtschaftlich zu den geringstmögli-chen Kosten bereitgestellt werden. Zur Überwindung der Reichweitenunsicherheit wird ein im Verhältnis zur Normalladeinfrastruktur geringeres Angebot an Schnellladeinfra-struktur als notwendig angesehen. Die Schnellladeinfrastruktur ist essenziell, um Bedenken potenzieller Kunden bezüglich der Reichweite und der ständigen Verfügbar-keit einer Lademöglichkeit auszuräumen. Um die Hochlaufkurven für Fahrzeuge zu erreichen, sollten zudem auch Nutzer ohne private Stellplätze eine bei Bedarf verfügbare Lademöglichkeit haben. Für Carsharing-Konzepte mit Elektrofahrzeugen ist Ladeinfra-struktur im öffentlich zugänglichen Raum zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzepts. Grundsätzlich lassen sich folgende drei Kategorien von Ladeinfrastruktur unter-scheiden: • (1) „Normalladen 1 im privaten Raum“: Dazu zählen Ladepunkte im privaten bezie- hungsweise gewerblichen Raum (Steckdose mit Absicherung und Zuleitung, Wallbox-Ladepunkt auf dem Firmengelände und im öffentlich zugänglichen Bereich). • (2) „Normalladen im öffentlichen Raum“: Dazu zählen Ladepunkte im rein öffentlichen Raum (Ladesäule am Straßenrand, innerorts). • (3) „Schnellladen 2 “: Dazu zählen Schnellladestationen an öffentlich zugänglichen und viel befahrenen Orten. Ausgangssituation Bisher hat die Energiewirtschaft in Deutschland mehr als 2.200 öffentlich zugängliche, also öffentliche und halböffentliche, Ladepunkte aufgebaut. Davon befinden sich über 1.000 Ladepunkte im rein öffentlichen Raum. Schnellladen wird derzeit an zwölf Stationen entlang der Autobahnen und in Städten angeboten. Im privaten Bereich zeigen zudem Erfahrungen aus den Modellregionen und -projekten, dass in der Regel jedes Elektrofahrzeug mit einem privaten Ladepunkt zu Hause oder am Arbeitsplatz ausgestattet wird. Bei aktuell rund 4.500 Elektrofahrzeugen in Deutsch-land existieren schätzungsweise auch etwa genauso viele private Ladepunkte.Zum 1. Januar diesen Jahres wiesen bereits 18 Städte in Deutschland mehr als zehn öffentlich zugängliche Ladestationen (in der Regel mit je zwei Ladepunkten) auf, siehe Tabelle. In 390 deutschen Städten wird mindestens eine Ladestation betrieben.Von den öffentlich zugänglichen Ladestationen verfügen ca. 60 % über eine maximale Leistung von 11 bis 22 kW. Der mit 55 % am häufigsten verwendete Anschluss ist Wechselstrom (AC) 3-phasig. 1 Normalladen umfasst Ladeleistungen bis 44 Kilowatt. 2 Ladeleistungen von bis zu 100 Kilowatt in Untersuchung, siehe Kapitel 4.1.5 IKT.
2 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 3 Der Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland hat vor allem in den Modellregionen und –projekten angefangen, entsprechend konzentriert sich die Verteilung auf der folgenden Karte auf diese Gebiete. Abbildung 1:Orte in Deutschland mit mehr als zehn öffentlich zugänglichen Ladestationen Berlin Hamburg Stuttgart Dortmund Frankfurt am Main München Essen Karlsruhe Düsseldorf 98 58 42 34 2 32 31 31 15 Ort Anzahl öffentlich zugänglicher Ladestationen (mit in der Regel je zwei Ladepunkten) Münster Leipzig Mülheim an der Ruhr Bremen Siegburg Aachen Bochum Kassel Osnabrück 15 14 14 13 11 10 10 10 10 Ort Anzahl öffentlich zugänglicher Ladestationen (mit in der Regel je zwei Ladepunkten) 0 bis unter 1 1 bis unter 2 2 bis unter 4 4 bis unter 10 10 bis unter 30 30 bis unter 40 40 bis unter 60 60 bis unter 100 Anzahl der Ladestationen Hamburg Hannover Rostock Berlin Leipzig Kiel Bremen Bremerhaven Oldenburg Münster Osnabrück Dortmund Essen Duisburg Aachen Köln Koblenz Bonn Siegen ach ch hh ac Frankfurt Trier Bielefeld Paderborn Mannheim Darmstadt Mainz Wiesbaden Nürnberg Erlangen Würzburg Saarbrücken Karlsruhe München Kempten Reutlingen Ulm Freiburg Stuttgart Bayreuth Bamberg Erfurt Ingolstadt Regensburg Augsburg Chemnitz Jena Gießen Marburg Kassel Potsdam Magdeburg Göttingen Halle Dresden Braunschweig Cottbus Wuppertal Düsseldorf Coburg Dessau-Roßlau Öffentlich zugängliche Ladestationenfür Elektrofahrzeuge je Gemeinde Quelle: Erhebung Ladeinfrastruktur Elektromobilität, BDEW, 2012
2 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 3 Der Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland hat vor allem in den Modellregionen und –projekten angefangen, entsprechend konzentriert sich die Verteilung auf der folgenden Karte auf diese Gebiete. Abbildung 1:Orte in Deutschland mit mehr als zehn öffentlich zugänglichen Ladestationen Berlin Hamburg Stuttgart Dortmund Frankfurt am Main München Essen Karlsruhe Düsseldorf 98 58 42 34 2 32 31 31 15 Ort Anzahl öffentlich zugänglicher Ladestationen (mit in der Regel je zwei Ladepunkten) Münster Leipzig Mülheim an der Ruhr Bremen Siegburg Aachen Bochum Kassel Osnabrück 15 14 14 13 11 10 10 10 10 Ort Anzahl öffentlich zugänglicher Ladestationen (mit in der Regel je zwei Ladepunkten) 0 bis unter 1 1 bis unter 2 2 bis unter 4 4 bis unter 10 10 bis unter 30 30 bis unter 40 40 bis unter 60 60 bis unter 100 Anzahl der Ladestationen Hamburg Hannover Rostock Berlin Leipzig Kiel Bremen Bremerhaven Oldenburg Münster Osnabrück Dortmund Essen Duisburg Aachen Köln Koblenz Bonn Siegen ach ch hh ac Frankfurt Trier Bielefeld Paderborn Mannheim Darmstadt Mainz Wiesbaden Nürnberg Erlangen Würzburg Saarbrücken Karlsruhe München Kempten Reutlingen Ulm Freiburg Stuttgart Bayreuth Bamberg Erfurt Ingolstadt Regensburg Augsburg Chemnitz Jena Gießen Marburg Kassel Potsdam Magdeburg Göttingen Halle Dresden Braunschweig Cottbus Wuppertal Düsseldorf Coburg Dessau-Roßlau Öffentlich zugängliche Ladestationenfür Elektrofahrzeuge je Gemeinde Quelle: Erhebung Ladeinfrastruktur Elektromobilität, BDEW, 2012
4 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 5 Um eine Prognose für den Bedarf speziell an rein öffentlicher Ladeinfrastruktur für das Jahr 2020 abzugeben, lag der Fokus der NPE vor allem auf der oben genannten Kategorie „Normalladen im öffentlichen Raum“. Diese Lademöglichkeit erfährt im Fortschrittsbericht der NPE (Dritter Bericht) besondere Aufmerksamkeit, da sie wirt-schaftlich nicht selbsttragend ist und da ihr Aufbau ein gemeinsames und regelgebun-denes Vorgehen mit Augenmaß der beteiligten Akteure erfordert: Investitionen im öffentlichen Raum mit öffentlicher und privater Finanzierung erfordern einen systemi-schen Ansatz von Kommunen, Genehmigungsinstanzen, Investoren und Betreibern von Ladeinfrastruktur. Beim Carsharing etwa ist gemeinsam die Frage zu lösen, wie eine optimale Auslastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur erreicht werden kann. Dazu zählt die Verweildauer bereits geladener Fahrzeuge oder auch der Umgang mit „Falschpar-kern“. Bei der Entscheidung, Pachtzins oder Sondernutzungsgebühren zu erheben, müssen Städte und Gemeinden bedenken, dass diese Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit weiter gefährden. Auch die Verpflichtung zu kurzfristigen Wartungsintervallen sollte überdacht werden. Gemäß der Bedarfsschätzung der NPE aus dem Zweiten Bericht sollen bis zum Jahr 2020 aus allen drei genannten Kategorien knapp 950.000 Ladepunkte zur Verfügung stehen - basierend auf der Annahme einer Hochlaufphase von einer Million Fahrzeugen. 60.000 7.000 8.500 Abbildung 2:Prognose der Ladepunkte bis2020 laut NPE-Szenario 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Zahlen für öffentliche Ladepunkte an Balken gerundet E-Fahrzeuge im Jahr 2014 100.000 2017 500.000 2020 1.000.000 Normalladen im öffentlichen Raum Normalladen im privaten Raum Schnellladen 150.000 Prognoseunsicherheit Summe Ladepunkte in 2020: 950.000 In Summe erfolgt daher der Aufbau von fast 800.000 der knapp 950.000 Ladepunk-te durch private Investoren. Dies schließt auch rund 7.000 Schnellladepunkte im Jahr 2020 ein – bei entsprechender Marktentwicklung könnten sich hier Geschäftsmodelle abzeichnen. Die 150.000 geschätzten öffentlichen Ladepunkte sind aus heutiger Sicht nur erreich-bar, wenn geeignete Rahmenbedingungen und entsprechende Finanzierungskonzepte vorliegen. Diese sicherheitsbewusste Schätzung ist jedoch tendenziell eine Obergrenze und wird mit Erkenntnissen aus den Schaufensterprojekten überprüft und angepasst. In der Grafik ist die hohe Schätzung daher als „Prognoseunsicherheit“ gekennzeichnet.Zudem könnten die im Zweiten Bericht geschätzten Investitionskosten von 4.700 bis 9.000 EUR je öffentlichem Ladepunkt durch zielgerichteten Einsatz einfacherer Basislö-sungen und durch generelle Kostenreduktion weiter sinken. Auch solche Ansätze sollten im Rahmen der Schaufensterprojekte weiter entwickelt werden. Der Investitionsbedarf wie auch eine Deckungslücke könnten nach unten korrigiert werden, wenn die Zahl der öffentlichen Ladepunkte reduziert wird oder wenn einfachere Basislösungen zum Einsatz kämen. Auf Basis der oben genannten Schätzungen des Zweiten Berichts entsprächen 150.000 öffentliche Ladepunkte einem Investitionsbedarf von 0,7 Milliarden EUR bis 1,35 Milliarden EUR. Wegen der geringen Umsätze pro Ladepunkt bei hohen Abschreibun-gen sowie Betriebs- und Wartungskosten ist mit einer jährlichen Deckungslücke von 500 bis 2.000 EUR je Ladepunkt zu rechnen. In Summe ergäbe sich eine Deckungslü-cke von bis zu 300 Millionen EUR im Jahr.Die Kofinanzierung öffentlicher Ladeinfrastruktur im Markthochlauf ist ähnlich wie bei anderen Infrastrukturen, beispielsweise der Breitbandausbau, nicht ungewöhnlich. Öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben ist derzeit rein privatwirt-schaftlich noch nicht zu realisieren. Dies zeigen auch internationale Vergleiche. Da auch ergänzende Geschäftszwecke wie die Nutzung der Ladestation als Werbefläche keinen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen oder kommunalrechtlichen Begrenzungen begeg-nen, bedarf es nach aktuellem Stand der Erkenntnis einer begrenzten Anschubfinanzie-rung und planungsrechtlicher Unterstützung. Finanzierungsbeispiele aus dem Ausland, die das Unterauslastungsproblem adres-sieren, liegen vor und zeigen bereits große Erfolge beim Aufbau öffentlicher Ladeinfra-struktur. Häufig wird der Aufbau aus öffentlichen Mitteln wie Steuern oder anderen Einnahmen finanziert, zum Beispiel als Fondslösungen (Großbritannien, Frankreich) oder Investitionskostenzuschüsse wie in den Niederlanden. Die Mittelverwendung kann zudem über Ausschreibungen und Projektfinanzierung mit einer diskriminierungsfreien Vergabe an verschiedene Bieter erfolgen. Andere Finanzierungsmodelle werden bisher nur vereinzelt genutzt: Die Umlagefinanzierung wird im Ausland nicht angewendet, die Netzentgeltfinanzierung nur in zwei Ländern (Italien und Irland) eingesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt kann basierend auf den Erfahrungen aus den Schaufensterprojekten entschieden werden, welche Finanzierungswege für Deutschland zu wählen sind. Ausblick Um abschätzen zu können, ob es sich perspektivisch um eine Anschub- oder Dauerfi-nanzierung handelt, hat die NPE den Bedarf der von 2020 bis 2030 auszubauenden öffentlichen Ladeinfrastruktur diskutiert: Wenn das Verhältnis von öffentlichem Lade-punkt zu Fahrzeug proportional im Zeitablauf gleich bliebe, würde ein dauerhafter, erheb-licher und steigender Subventionsbedarf für die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum entstehen. Die NPE kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Anzahl der rein öffentlichen Ladestellen keineswegs dauerhaft proportional zur Anzahl der E-Fahrzeuge steigen muss.
4 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 5 Um eine Prognose für den Bedarf speziell an rein öffentlicher Ladeinfrastruktur für das Jahr 2020 abzugeben, lag der Fokus der NPE vor allem auf der oben genannten Kategorie „Normalladen im öffentlichen Raum“. Diese Lademöglichkeit erfährt im Fortschrittsbericht der NPE (Dritter Bericht) besondere Aufmerksamkeit, da sie wirt-schaftlich nicht selbsttragend ist und da ihr Aufbau ein gemeinsames und regelgebun-denes Vorgehen mit Augenmaß der beteiligten Akteure erfordert: Investitionen im öffentlichen Raum mit öffentlicher und privater Finanzierung erfordern einen systemi-schen Ansatz von Kommunen, Genehmigungsinstanzen, Investoren und Betreibern von Ladeinfrastruktur. Beim Carsharing etwa ist gemeinsam die Frage zu lösen, wie eine optimale Auslastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur erreicht werden kann. Dazu zählt die Verweildauer bereits geladener Fahrzeuge oder auch der Umgang mit „Falschpar-kern“. Bei der Entscheidung, Pachtzins oder Sondernutzungsgebühren zu erheben, müssen Städte und Gemeinden bedenken, dass diese Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit weiter gefährden. Auch die Verpflichtung zu kurzfristigen Wartungsintervallen sollte überdacht werden. Gemäß der Bedarfsschätzung der NPE aus dem Zweiten Bericht sollen bis zum Jahr 2020 aus allen drei genannten Kategorien knapp 950.000 Ladepunkte zur Verfügung stehen - basierend auf der Annahme einer Hochlaufphase von einer Million Fahrzeugen. 60.000 7.000 8.500 Abbildung 2:Prognose der Ladepunkte bis2020 laut NPE-Szenario 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Zahlen für öffentliche Ladepunkte an Balken gerundet E-Fahrzeuge im Jahr 2014 100.000 2017 500.000 2020 1.000.000 Normalladen im öffentlichen Raum Normalladen im privaten Raum Schnellladen 150.000 Prognoseunsicherheit Summe Ladepunkte in 2020: 950.000 In Summe erfolgt daher der Aufbau von fast 800.000 der knapp 950.000 Ladepunk-te durch private Investoren. Dies schließt auch rund 7.000 Schnellladepunkte im Jahr 2020 ein – bei entsprechender Marktentwicklung könnten sich hier Geschäftsmodelle abzeichnen. Die 150.000 geschätzten öffentlichen Ladepunkte sind aus heutiger Sicht nur erreich-bar, wenn geeignete Rahmenbedingungen und entsprechende Finanzierungskonzepte vorliegen. Diese sicherheitsbewusste Schätzung ist jedoch tendenziell eine Obergrenze und wird mit Erkenntnissen aus den Schaufensterprojekten überprüft und angepasst. In der Grafik ist die hohe Schätzung daher als „Prognoseunsicherheit“ gekennzeichnet.Zudem könnten die im Zweiten Bericht geschätzten Investitionskosten von 4.700 bis 9.000 EUR je öffentlichem Ladepunkt durch zielgerichteten Einsatz einfacherer Basislö-sungen und durch generelle Kostenreduktion weiter sinken. Auch solche Ansätze sollten im Rahmen der Schaufensterprojekte weiter entwickelt werden. Der Investitionsbedarf wie auch eine Deckungslücke könnten nach unten korrigiert werden, wenn die Zahl der öffentlichen Ladepunkte reduziert wird oder wenn einfachere Basislösungen zum Einsatz kämen. Auf Basis der oben genannten Schätzungen des Zweiten Berichts entsprächen 150.000 öffentliche Ladepunkte einem Investitionsbedarf von 0,7 Milliarden EUR bis 1,35 Milliarden EUR. Wegen der geringen Umsätze pro Ladepunkt bei hohen Abschreibun-gen sowie Betriebs- und Wartungskosten ist mit einer jährlichen Deckungslücke von 500 bis 2.000 EUR je Ladepunkt zu rechnen. In Summe ergäbe sich eine Deckungslü-cke von bis zu 300 Millionen EUR im Jahr.Die Kofinanzierung öffentlicher Ladeinfrastruktur im Markthochlauf ist ähnlich wie bei anderen Infrastrukturen, beispielsweise der Breitbandausbau, nicht ungewöhnlich. Öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben ist derzeit rein privatwirt-schaftlich noch nicht zu realisieren. Dies zeigen auch internationale Vergleiche. Da auch ergänzende Geschäftszwecke wie die Nutzung der Ladestation als Werbefläche keinen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen oder kommunalrechtlichen Begrenzungen begeg-nen, bedarf es nach aktuellem Stand der Erkenntnis einer begrenzten Anschubfinanzie-rung und planungsrechtlicher Unterstützung. Finanzierungsbeispiele aus dem Ausland, die das Unterauslastungsproblem adres-sieren, liegen vor und zeigen bereits große Erfolge beim Aufbau öffentlicher Ladeinfra-struktur. Häufig wird der Aufbau aus öffentlichen Mitteln wie Steuern oder anderen Einnahmen finanziert, zum Beispiel als Fondslösungen (Großbritannien, Frankreich) oder Investitionskostenzuschüsse wie in den Niederlanden. Die Mittelverwendung kann zudem über Ausschreibungen und Projektfinanzierung mit einer diskriminierungsfreien Vergabe an verschiedene Bieter erfolgen. Andere Finanzierungsmodelle werden bisher nur vereinzelt genutzt: Die Umlagefinanzierung wird im Ausland nicht angewendet, die Netzentgeltfinanzierung nur in zwei Ländern (Italien und Irland) eingesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt kann basierend auf den Erfahrungen aus den Schaufensterprojekten entschieden werden, welche Finanzierungswege für Deutschland zu wählen sind. Ausblick Um abschätzen zu können, ob es sich perspektivisch um eine Anschub- oder Dauerfi-nanzierung handelt, hat die NPE den Bedarf der von 2020 bis 2030 auszubauenden öffentlichen Ladeinfrastruktur diskutiert: Wenn das Verhältnis von öffentlichem Lade-punkt zu Fahrzeug proportional im Zeitablauf gleich bliebe, würde ein dauerhafter, erheb-licher und steigender Subventionsbedarf für die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum entstehen. Die NPE kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Anzahl der rein öffentlichen Ladestellen keineswegs dauerhaft proportional zur Anzahl der E-Fahrzeuge steigen muss.
6 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 7 Vielmehr gibt es Hinweise für einen Sättigungspunkt aus zwei Analogien aus anderen Infrastrukturmärkten – Tankstellen und Telekommunikation – mit Eintritt einer Sättigung: In der Phase des Markthochlaufs wächst die jeweilige Infrastruktur (im Falle der Pkw stieg die Zahl der Tankstellen, im Falle der Telefonnutzung die Zahl der Telefonzellen) proportional mit. Im Massenmarkt wird ein Sättigungspunkt erreicht. Dann setzen sich auch leistungsfähigere beziehungsweise disruptive Technologien durch (zum Beispiel das Mobiltelefon als eine Art Substitut für Telefonzellen). Nach der Marktdurchdringung geht der Bedarf zurück und verbleibt auf einem Mindestniveau. • Analogie 1: Der Tankstellenmarkt: Der beginnende Massenmarkt für Pkw war durch relativ viele Tankstellen gekennzeich-net. Eine Tankstelle versorgte im Jahr 1970 nur 300 Autos. Damals gab es schätzungs-weise maximal zehn Zapfschläuche pro Tankstelle. Dies ergab rückblickend eine Nutzungsquote von 30 Autos pro Zapfpunkt. Danach stieg die Kennziffer Fahrzeuge pro Tankstelle steil an. Treiber dieser Entwicklung waren steigende Kosten für Personal und – durch die Ölkrise – für Kraftstoff. Diese Entwicklung beförderte die Einführung wesentlicher technischer Neuerungen. Dazu gehörte neben der elektronischen Erfas-sung von Tankvorgängen auch eine neue Generation von Zapfsäulen, die die Abgabe von bis zu fünf verschiedenen Kraftstoffen je Säulenseite ermöglichte. So konnten Ende der 1970er Jahre an Zapfsäulen bis zu fünf verschiedene Kraftstoffe je Zapfsäulenseite abgegeben werden. Das macht zehn Ladepunkte pro Zapfsäule. Heute hat eine Tank-stelle viel mehr Zapfsäulen, die Kurven sind in der Tendenz ein wenig steil, doch im Fokus steht die Aussage, dass damals im Stadium des Massenmarktes ein Sättigungs-punkt bei der Infrastruktur eintrat. Abbildung 3:Marktentwicklung Pkw und Tankstellen in Deutschland 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Jahr Anzahl 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Quelle: AG 3 der NPE Anza hl der Pk w in Tausend (Achse link s) Anza hl ö ffentliche zugä nglicher Ta nk stellen (Achse link s) F a hrzeuge pro Ta nk stelle (Achse rechts) • Analogie 2: Der Telefonzellenmarkt Die Einführung des Telefons fand in nicht unerheblicher Weise über den Aufbau eines Netzes an öffentlichen Telefonzellen statt. Die Spitze der Anzahl dieser Telefonzellen war 1994 mit 166.000 Stück erzielt – wirtschaftlich war und ist dieses Geschäft übrigens immer ein nicht kostendeckendes Verlustgeschäft geblieben.Auch bei der Anzahl der Telefonzellen kam es zu einer Sättigung und später zu einem Rückgang. Technologische Neuerungen, wie nicht zuletzt die Entwicklung von mobilen Endgeräten, haben dazu genauso beigetragen wie in den frühen Jahren die steigende Verfügbarkeit von Festnetzanschlüssen im häuslichen Bereich. Abbildung 4:Marktentwicklung Telefonanschlüsse fest und mobil in Deutschland 0 160.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 180.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Jahr Anzahl 1950 1960 1960 1970 1984 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: AG 3 der NPE Anza hl der ö ffentlichen Telefonzellen (Achse link s) Anza hl der F e stne tzanschüsse in Tausend (a b 2006 neue Sta tistik) Anza hl der Mobilfunk ver träge (Achse rechts) Bezogen auf die Ladeinfrastruktur deuten die Analogien auf zwei Entwicklungen hin, die den Bedarf bremsen: 1) die steigende Auslastung der Ladepunkte, zum einen durch eine höhere Marktdurch- dringung (mehr Ladevorgänge pro Ladepunkt), zum anderen durch leistungsfähigere Batterien mit höheren Reichweiten (längere Ladevorgänge pro Ladepunkt) 2) die zunehmende Verbreitung von Schnellladen als eine disruptive Technologie – hierdurch kann ein Ladepunkt täglich ein Vielfaches an Kunden im Vergleich zum Normalladen bedienen Da langfristig die elektrische Leistung pro öffentlich zugänglichem Ladepunkt steigen wird, sollte parallel zum Infrastrukturaufbau der Ausbaubedarf des Stromnetzes unter-sucht werden. Mit Blick auf etwa das Jahr 2025 dürften Netzausbaumaßnahmen anfallen, die frühzeitig mitgeplant und entsprechend reguliert, das heißt in den Netzent-gelten berücksichtigt, werden sollten.
6 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen 7 Vielmehr gibt es Hinweise für einen Sättigungspunkt aus zwei Analogien aus anderen Infrastrukturmärkten – Tankstellen und Telekommunikation – mit Eintritt einer Sättigung: In der Phase des Markthochlaufs wächst die jeweilige Infrastruktur (im Falle der Pkw stieg die Zahl der Tankstellen, im Falle der Telefonnutzung die Zahl der Telefonzellen) proportional mit. Im Massenmarkt wird ein Sättigungspunkt erreicht. Dann setzen sich auch leistungsfähigere beziehungsweise disruptive Technologien durch (zum Beispiel das Mobiltelefon als eine Art Substitut für Telefonzellen). Nach der Marktdurchdringung geht der Bedarf zurück und verbleibt auf einem Mindestniveau. • Analogie 1: Der Tankstellenmarkt: Der beginnende Massenmarkt für Pkw war durch relativ viele Tankstellen gekennzeich-net. Eine Tankstelle versorgte im Jahr 1970 nur 300 Autos. Damals gab es schätzungs-weise maximal zehn Zapfschläuche pro Tankstelle. Dies ergab rückblickend eine Nutzungsquote von 30 Autos pro Zapfpunkt. Danach stieg die Kennziffer Fahrzeuge pro Tankstelle steil an. Treiber dieser Entwicklung waren steigende Kosten für Personal und – durch die Ölkrise – für Kraftstoff. Diese Entwicklung beförderte die Einführung wesentlicher technischer Neuerungen. Dazu gehörte neben der elektronischen Erfas-sung von Tankvorgängen auch eine neue Generation von Zapfsäulen, die die Abgabe von bis zu fünf verschiedenen Kraftstoffen je Säulenseite ermöglichte. So konnten Ende der 1970er Jahre an Zapfsäulen bis zu fünf verschiedene Kraftstoffe je Zapfsäulenseite abgegeben werden. Das macht zehn Ladepunkte pro Zapfsäule. Heute hat eine Tank-stelle viel mehr Zapfsäulen, die Kurven sind in der Tendenz ein wenig steil, doch im Fokus steht die Aussage, dass damals im Stadium des Massenmarktes ein Sättigungs-punkt bei der Infrastruktur eintrat. Abbildung 3:Marktentwicklung Pkw und Tankstellen in Deutschland 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Jahr Anzahl 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Quelle: AG 3 der NPE Anza hl der Pk w in Tausend (Achse link s) Anza hl ö ffentliche zugä nglicher Ta nk stellen (Achse link s) F a hrzeuge pro Ta nk stelle (Achse rechts) • Analogie 2: Der Telefonzellenmarkt Die Einführung des Telefons fand in nicht unerheblicher Weise über den Aufbau eines Netzes an öffentlichen Telefonzellen statt. Die Spitze der Anzahl dieser Telefonzellen war 1994 mit 166.000 Stück erzielt – wirtschaftlich war und ist dieses Geschäft übrigens immer ein nicht kostendeckendes Verlustgeschäft geblieben.Auch bei der Anzahl der Telefonzellen kam es zu einer Sättigung und später zu einem Rückgang. Technologische Neuerungen, wie nicht zuletzt die Entwicklung von mobilen Endgeräten, haben dazu genauso beigetragen wie in den frühen Jahren die steigende Verfügbarkeit von Festnetzanschlüssen im häuslichen Bereich. Abbildung 4:Marktentwicklung Telefonanschlüsse fest und mobil in Deutschland 0 160.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 180.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Jahr Anzahl 1950 1960 1960 1970 1984 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle: AG 3 der NPE Anza hl der ö ffentlichen Telefonzellen (Achse link s) Anza hl der F e stne tza nschüsse in Ta usend (a b 2006 neue Sta tistik) Anza hl der Mobilfunk ver träge (Achse rechts) Bezogen auf die Ladeinfrastruktur deuten die Analogien auf zwei Entwicklungen hin, die den Bedarf bremsen: 1) die steigende Auslastung der Ladepunkte, zum einen durch eine höhere Marktdurch- dringung (mehr Ladevorgänge pro Ladepunkt), zum anderen durch leistungsfähigere Batterien mit höheren Reichweiten (längere Ladevorgänge pro Ladepunkt) 2) die zunehmende Verbreitung von Schnellladen als eine disruptive Technologie – hierdurch kann ein Ladepunkt täglich ein Vielfaches an Kunden im Vergleich zum Normalladen bedienen Da langfristig die elektrische Leistung pro öffentlich zugänglichem Ladepunkt steigen wird, sollte parallel zum Infrastrukturaufbau der Ausbaubedarf des Stromnetzes unter-sucht werden. Mit Blick auf etwa das Jahr 2025 dürften Netzausbaumaßnahmen anfallen, die frühzeitig mitgeplant und entsprechend reguliert, das heißt in den Netzent-gelten berücksichtigt, werden sollten.
8 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Mit der Gestaltung der Schaufensterregionen haben öffentliche und private Akteure nun die Möglichkeit, gemeinsam verschiedene Infrastrukturlösungen – vor allem den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur und die Möglichkeit des Schnellladens –, deren Kundennutzen und damit mögliche Geschäftsmodelle zu erproben und zu überprüfen. Dies schließt auch Finanzierungsmodelle ein, wie etwa gemischte Finanzierung. An-schubfinanzierungen, sowohl für Normalladen im öffentlichen Raum als auch für Schnell-laden, erscheinen daher für den Übergang von Marktvorbereitung zur Phase des Markthochlaufs sinnvoll. Die Erkenntnisse aus den Schaufensterprojekten zum nötigen Umfang von Ladeinfrastruktur werden in den nächsten NPE-Bericht einfließen. Fazit • Die Tatsache, dass öffentliche Ladeinfrastruktur, wie Infrastrukturen anderer Bereiche (zum Beispiel Breitbandausbau etc.), im Markthochlauf kofinanziert wird, ist nicht ungewöhnlich. Dies zeigen auch internationale Vergleiche (Großbritannien, Irland, Niederlande, Frankreich etc.). Öffentliche Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben ist derzeit unter ökonomischen Gesichtspunkten rein privatwirtschaftlich noch nicht darstellbar. Da auch ergänzende Geschäftszwecke, wie die Vermietung von Werbeflä-chen, zur Zeit noch keinen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen oder ebenfalls kommunalrechtlichen Begrenzungen begegnen, bedürfte es nach aktuellem Stand der Erkenntnis einer Anschubfinanzierung und planungsrechtlicher Unterstützung. • Je schneller leistungsfähigere Technologien, höhere Marktdurchdringung und ausrei-chend private Ladeinfrastruktur zum Einsatz kommen, desto geringer der Bedarf an öffentlicher Infrastruktur. Wenn beispielsweise Schnellladen sowohl an Autobahnen als auch in Innenstädten verfügbar ist, werden Fahrer auch unabhängig von ihrer privaten Wohn- oder Arbeitsstätte eine relativ unkomplizierte Lademöglichkeit haben und sind weniger auf öffentliche Ladestellen am Straßenrand angewiesen. • Daher sollte öffentliche Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren mit Augenmaß entsprechend dem tatsächlichen E-Fahrzeughochlauf aufgebaut werden. Gleichzeitig sollte forciert untersucht werden, welche weiteren Entwicklungen im Fahrzeug- und Batteriebereich heutige Ladelösungen bedienen können. Die Anzahl der rein öffentlichen Ladestellen wird daher keineswegs dauerhaft proportio-nal zur Anzahl der E-Fahrzeuge steigen müssen. Nach 2020 kann E-Mobilität mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine breite Förderung von – insbesondere öffentlichen – Ladein-frastrukturen verzichten und dabei verstärkt auf den Aufbau privat finanzierter Lade-punkte im öffentlich zugänglichen Bereich setzen. Verfasser Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) AG 3 – Ladeinfrastruktur und Netzintegration Berlin/ München, Juni 2012 Redaktionelle Unterstützung acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Ariane Hellinger, Michael Püschner, Linda Tönskötter (Lektorat) www.acatech.de Satz und Gestaltung heilmeyerundsernau.com Infographik isotype.com
8 Elektrofahrzeuge intelligent ans Netz bringen Mit der Gestaltung der Schaufensterregionen haben öffentliche und private Akteure nun die Möglichkeit, gemeinsam verschiedene Infrastrukturlösungen – vor allem den Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur und die Möglichkeit des Schnellladens –, deren Kundennutzen und damit mögliche Geschäftsmodelle zu erproben und zu überprüfen. Dies schließt auch Finanzierungsmodelle ein, wie etwa gemischte Finanzierung. An-schubfinanzierungen, sowohl für Normalladen im öffentlichen Raum als auch für Schnell-laden, erscheinen daher für den Übergang von Marktvorbereitung zur Phase des Markthochlaufs sinnvoll. Die Erkenntnisse aus den Schaufensterprojekten zum nötigen Umfang von Ladeinfrastruktur werden in den nächsten NPE-Bericht einfließen. Fazit • Die Tatsache, dass öffentliche Ladeinfrastruktur, wie Infrastrukturen anderer Bereiche (zum Beispiel Breitbandausbau etc.), im Markthochlauf kofinanziert wird, ist nicht ungewöhnlich. Dies zeigen auch internationale Vergleiche (Großbritannien, Irland, Niederlande, Frankreich etc.). Öffentliche Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben ist derzeit unter ökonomischen Gesichtspunkten rein privatwirtschaftlich noch nicht darstellbar. Da auch ergänzende Geschäftszwecke, wie die Vermietung von Werbeflä-chen, zur Zeit noch keinen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen oder ebenfalls kommunalrechtlichen Begrenzungen begegnen, bedürfte es nach aktuellem Stand der Erkenntnis einer Anschubfinanzierung und planungsrechtlicher Unterstützung. • Je schneller leistungsfähigere Technologien, höhere Marktdurchdringung und ausrei-chend private Ladeinfrastruktur zum Einsatz kommen, desto geringer der Bedarf an öffentlicher Infrastruktur. Wenn beispielsweise Schnellladen sowohl an Autobahnen als auch in Innenstädten verfügbar ist, werden Fahrer auch unabhängig von ihrer privaten Wohn- oder Arbeitsstätte eine relativ unkomplizierte Lademöglichkeit haben und sind weniger auf öffentliche Ladestellen am Straßenrand angewiesen. • Daher sollte öffentliche Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren mit Augenmaß entsprechend dem tatsächlichen E-Fahrzeughochlauf aufgebaut werden. Gleichzeitig sollte forciert untersucht werden, welche weiteren Entwicklungen im Fahrzeug- und Batteriebereich heutige Ladelösungen bedienen können. Die Anzahl der rein öffentlichen Ladestellen wird daher keineswegs dauerhaft proportio-nal zur Anzahl der E-Fahrzeuge steigen müssen. Nach 2020 kann E-Mobilität mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine breite Förderung von – insbesondere öffentlichen – Ladein-frastrukturen verzichten und dabei verstärkt auf den Aufbau privat finanzierter Lade-punkte im öffentlich zugänglichen Bereich setzen. Verfasser Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) AG 3 – Ladeinfrastruktur und Netzintegration Berlin/ München, Juni 2012 Redaktionelle Unterstützung acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Ariane Hellinger, Michael Püschner, Linda Tönskötter (Lektorat) www.acatech.de Satz und Gestaltung heilmeyerundsernau.com Infographik isotype.com