Warenkorb
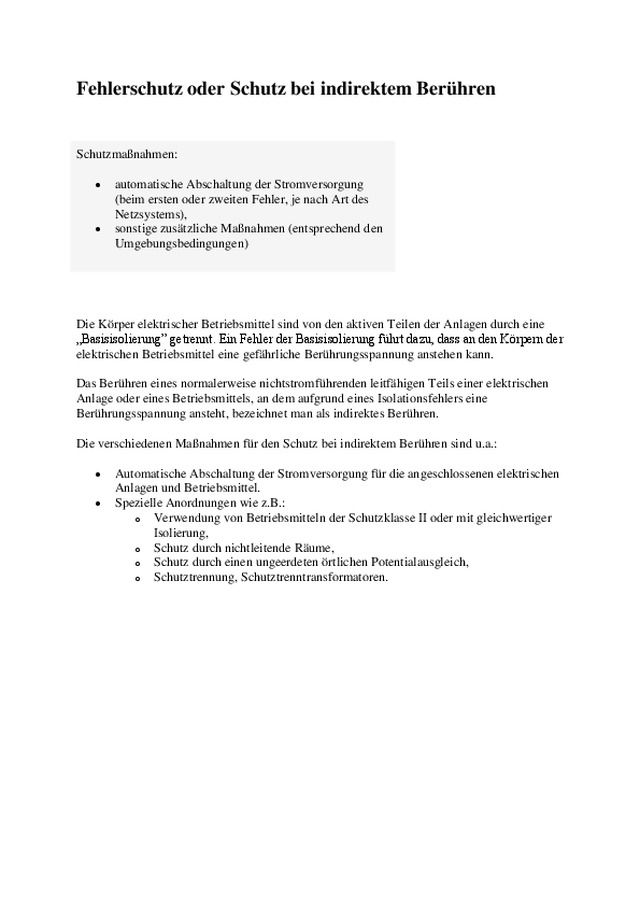
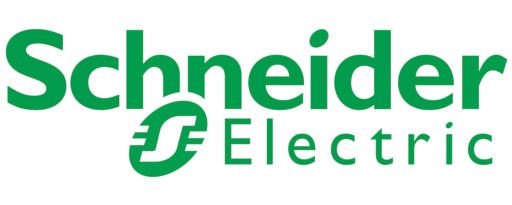
Grundlagenreihe Schutz gegen elektrischen Schlag: Teil 3 Fehlerschutz oder Schutz bei indirektem Berühren
Der Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag in NS-Anlagen muss nach den entsprechenden nationalen Normen, gesetzlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften usw. gewährleistet sein.
Fehlerschutz oder Schutz bei indirektem Berühren Schutzmaßnahmen: automatische Abschaltung der Stromversorgung (beim ersten oder zweiten Fehler, je nach Art des Netzsystems), sonstige zusätzliche Maßnahmen (entsprechend den Umgebungsbedingungen) Die Körper elektrischer Betriebsmittel sind von den aktiven Teilen der Anlagen durch eine „Basisisolierung” getrennt. Ein Fehler der Basisisolierung führt dazu, dass an den Körpern der elektrischen Betriebsmittel eine gefährliche Berührungsspannung anstehen kann. Das Berühren eines normalerweise nichtstromführenden leitfähigen Teils einer elektrischen Anlage oder eines Betriebsmittels, an dem aufgrund eines Isolationsfehlers eine Berührungsspannung ansteht, bezeichnet man als indirektes Berühren. Die verschiedenen Maßnahmen für den Schutz bei indirektem Berühren sind u.a.: Automatische Abschaltung der Stromversorgung für die angeschlossenen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel. Spezielle Anordnungen wie z.B.: o Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II oder mit gleichwertiger Isolierung, o Schutz durch nichtleitende Räume, o Schutz durch einen ungeerdeten örtlichen Potentialausgleich, o Schutztrennung, Schutztrenntransformatoren.
Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung Prinzip Der Schutz bei indirektem Berühren durch automatische Abschaltung der Stromversorgung ist gewährleistet, wenn die Körper elektrischer Betriebsmittel mit einem niederohmigen Schutzleiter verbunden sind. Diese Schutzmaßnahme erfordert die Koordination zwischen dem Netzsystem und den Eigenschaften der Schutzleiter und Schutzeinrichtungen. Die Anforderungen für diese Schutzmaßnahme und die Abschaltzeiten werden unter Berücksichtigung von IEC 60479-1 (VDE V 0140-479-1) festgelegt. Daher müssen die Körper unter den für jedes Netzsystem festgelegten Bedingungen an einen Schutzleiter angeschlossen werden. (Gleichzeitig berührbare Körper müssen an demselben Schutzleiter/Erdungssystem angeschlossen werden.) Außerdem müssen in jedem Gebäude der Hauptschutzleiter, der Haupterdungsleiter, die Haupterdungsklemme oder -schiene und die folgenden fremden, leitfähigen Teile zu einem Hauptpotentialausgleich verbunden werden: metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes, z.B. für Gas, für Wasser, Metallteile der Gebäudekonstruktionen, Zentralheizungs- und Klimaanlagen, wesentliche metallene Verstärkung von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit möglich. Je größer der Wert von U B [1] ist, desto schneller muss die Versorgungsspannung zur Gewährleistung des Schutzes abgeschaltet werden (siehe Abb. F8). Der höchste dauernd zulässige Wert von UB beträgt 50 V AC bzw. 120 V DC. Erinnerung: max. zulässige Abschaltzeiten nach IEC 60364-4-41 (VDE 0100-410). System AC DC 50 V U o ≤ 120 V AC DC 120 V U o ≤ 230 V AC DC 230 V U o ≤ 400 V DC U o 400 V TT 0,8 s s. Anm.1 0,4 s 5 s 0,2 s 0,4 s 0,1 s 0,1 s TN 0,3 s s. Anm.1 0,2 s 0,4 s 0,07s 0,2 s 0,04s 0,1 s Abb. F8: Maximal zulässige Dauer gegebener AC-Berührungsspannungswerte (in s)
Wenn in TT-Systemen die Abschaltung durch eine Überstrom-Schutzeinrichtung erreicht wird und alle fremden leitfähigen Teile in der Anlage an den Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene angeschlossen sind, darf die auf TN-Systeme anwendbare Abschaltzeit verwendet werden. U o : Nennwechsel- oder Nenngleichspannung Außenleiter gegen Erde Anmerkung 1: Eine Abschaltung kann aus anderen Gründen als dem Schutz gegen elektrischen Schlag verlangt sein. Anmerkung 1. ^ Die Berührungsspannung UB ist die vorhandene Spannung (als Folge eines Isolationsfehlers) zwischen einem berührbaren leitfähigen Teil und jedem beliebigen leitenden zugänglichen Teil mit anderem Potential (i. Allg. Erde). Automatische Abschaltung in TT-Systemen Prinzip Die automatische Abschaltung im TT-System wird in den allermeisten Fällen nur durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom erreicht, der von folgender Bedingung abhängig ist: , wobei R A dem Widerstand des Anlagenerders der Anlage entspricht. In diesem System müssen alle Körper der Anlage mit einem gemeinsamen Erdungsanschluss verbunden sein. Der Sternpunkt des Versorgungssystems ist normalerweise an einem Punkt außerhalb des Einflussbereiches des Anlagenerders geerdet. Die Erdschlussschleifenimpedanz besteht daher im Wesentlichen aus den zwei in Reihe liegenden Erdungswiderständen (d.h. dem Quellen und Anlagenanschluss), so dass der Fehlerstrom, der darüber zum Fließen kommen kann, im Allgemeinen zu niedrig ist, um die Überstrom-Schutzeinrichtung ansprechen zu lassen. Daher ist die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) fast zwingend notwendig. Dieses Schutzprinzip ist auch anwendbar, wenn nur ein gemeinsamer Erdungsanschluss verwendet wird, besonders im Fall einer Kundenstation innerhalb der Anlage, in der die Platzbeschränkung den Einsatz eines TN-Systems erfordert, aber alle anderen Voraussetzungen eines TN-Systems nicht erfüllt werden können. Die automatische Abschaltung der Stromversorgung im TT-System wird durch Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von:
durchgeführt, wobei gilt: R A : Summe der Widerstände des Erders und des Schutzleiters der Körper I ∆n : Bemessungsdifferenzstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) Für vorübergehend errichtete Versorgungen für den Einsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau wird der Wert 50 V durch 25 V ersetzt. Beispiel (siehe Abb. F9) Der Widerstand des Betriebserders am Sternpunkt in der Umspannstation RBA beträgt 10 Ω. Der Widerstand des Anlagenerders R A beträgt 20 Ω. Der Fehlerstrom ergibt sich aus: U/R ges = 230 V/30 Ω = I d = 7,7 A. Die Berührungsspannung beträgt U B = I d x R A = 154 V und ist daher gefährlich und muss abgeschaltet werden. Abb. F9: Automatische Abschaltung der Stromversorgung im TT-System Um die zulässige Berührungsspannung von AC 50 V am Erder nicht zu überschreiten, muss mindestens folgender Bemessungsdifferenzstrom gewählt werden: I ∆n = 50 V/20 Ω = 2,5 A. In der Praxis würde man dafür einen Bemessungsdifferenzstrom von 300 mA wählen, da letztlich auch der Schutzleitwiderstand in der Betrachtung mit berücksichtigt werden muss, so dass eine 300 mA-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in ca. 30 ms (siehe Abb. F10) unverzögert auslöst und den Fehler beseitigt, wenn die Berührungsspannung an einem berührbaren leitfähigen Teil überschritten wird.
U o [1] (V) T (s) 50 U o ≤ 120 0,3 120 U o ≤ 230 0,2 230 U o ≤ 400 0,07 U o 400 0,04 [1] U o = Nennspannung zwischen Außenleiter und Erde. Abb. F10: Max. Abschaltzeit für Wechselspannungs-Endstromkreise unter 32 A im TT-System Festgelegte maximale Abschaltzeit Die Abschaltzeiten von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) sind herstellerspezifisch im Allgemeinen kürzer als in den Normen gefordert wird. Diese Eigenschaft vereinfacht deren Verwendung und ermöglicht den Einsatz eines effektiven Selektivschutzes. In der Norm IEC 60364-4-41 (VDE 0100-410) ist die maximale Abschaltzeit von Schutzeinrichtungen im TT-System festgelegt: Für alle Endstromkreise mit einem Bemessungsstrom bis einschließlich 32 A liegt die maximale Abschaltzeit unter den Werten in Abbildung F10. Für Verteilungsstromkreise beträgt die maximale Abschaltzeit 1 s. Dieser Grenzwert ermöglicht Selektivität zwischen den in Verteilungsstromkreisen installierten Schaltgeräten mit Fehlerstromschutz. Der Begriff „Fehlerstromschutzgerät” wird allgemein für alle Geräte verwendet, die nach dem Fehlerstrom-Prinzip arbeiten. Die Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter (Residual Current Operated Circuit-Breaker = RCCB) sind nach den Normen der Reihe IEC 61008 (VDE 0664-10) vorwiegend Fehlerstrom-/Differenzstromschutzschalter ohne eingebautem Überstromschutz (RCCBs) für Hausinstallation und ähnliche Anwendungen. Die Abschaltzeit/Fehlerstrom-Kenndaten von Schaltgeräten mit Fehlerstromschutz vom Typ allgemein und Typ S (selektiv) der Norm IEC 61008 (VDE 0664-10) werden in Abb. F11 dargestellt. Diese Kenndaten ermöglichen gewisse selektive Auslösungen zwischen den verschiedenen Kenndaten- und Typenkombinationen, wie später in Abschnitt 4.3 beschrieben wird. Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (nach VDE 0660-101) gewährleisten aufgrund ihrer flexiblen Zeitverzögerung weitere Selektivitätsmöglichkeiten. Typ x I Δn 1 2 5 5 allgemein Typ S jeder Wert 0,3 0,15 0,04 0,04 höchstzulässige Abschaltzeiten 0,030 0,5 0,2 0,15 0,15 höchstzulässige Abschaltzeiten 0,13 0,06 0,05 0,04 kürzeste Nichtauslösezeiten Abb. F11: Höchstzulässige Abschaltzeiten von Schaltgeräten mit Fehlerstromschutz (in s)