Warenkorb
0 Punkte
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
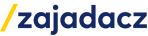
Unbekannt
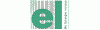
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
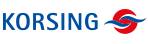
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
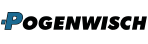
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
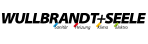
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt


Faktencheck Gebäudeenergieeffizienz
Faktencheck Gebäudeenergieeffizienz
Unsere Mitglieder
Unsere Mitglieder
3 Die Bundesregierung hat für den Gebäudesektor, verantwortlich für etwa 40 Prozent des Energiever-brauchs, ambitionierte Einsparziele festgelegt. Tatsächlich sind die Energieeffizienzpotenziale im Gebäudebereich – gerade im Vergleich zu anderen Sektoren – besonders groß und in 90 Prozent aller Fälle wirtschaftlich zu heben. Damit wird deutlich, dass Gebäuden eine entschei-dende Bedeutung im Hinblick auf die Neuaus-richtung der deutschen Energie- und Klimapolitik zukommen muss. Der BDI unterstützt die beschlos-sene Energiewende ausdrücklich, erwartet jedoch, dass diese nun professionell umgesetzt wird, um unsere Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern bzw. neu zu schaffen. Die jährliche Sanierungsquote von Bestandsgebäu-den liegt heute bei nur knapp einem Prozent. Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäude-bestands bis zum Jahr 2050 zu erreichen, müssen wir schnell handeln. Es bedarf eines langfristig angelegten Gesamtkonzepts zur freiwilligen Mo-tivation der Investoren in Deutschland. Nur so ist eine Verdoppelung der Sanierungsquote sowohl bei Wohn- wie bei Nichtwohngebäuden erreich-bar. Bliebe es beim Status quo, so würden nicht nur die Ziele im Gebäudebereich unerreichbar bleiben; auch der erfolgreiche Vollzug der Energiewende ins-gesamt würde noch stärker in Gefahr geraten. Der Bestand im Gebäudesektor ist sehr vielschich-tig und daher individuell zu betrachten. Viele Mil-lionen Gebäudeeigentümer in Deutschland sind zudem verunsichert und haben Informations-defizite. Es ist bisher nicht gelungen, die dringend notwendige Sanierungswelle auszulösen. Im Ge-genteil: Der Gebäudesektor verharrt im Stillstand. Dies ist besonders ärgerlich, da durch energetische Sanierungen am Ende alle profitieren können: Eigentümer und Investoren, Mieter und Vermieter, Klima und Umwelt. Die BDI-Initiative » Energieeffiziente Gebäude« ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und wissenschaftlichen Instituten, der das Ziel verfolgt, das Thema Energie-effizienz bei Gebäuden umfassend zu diskutieren, Rahmenbedingungen mitzugestalten und prakti-sche Wege zu einer erfolgreichen Energiewende auf-zuzeigen. Mit dem vorliegenden Faktencheck Gebäude energieeffizienz wollen wir gängige Aussagen – und teilweise Irrtümer – zu diesem Thema klarstellen und einen konstruktiven Beitrag zu öffentlichen Diskussion liefern. BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz Deutschland zukunftsfähig machen: »Energieeffizienz bei Gebäuden« als Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende Vorwort Dr. Matthias HenselVorsitzender derBDI-Initiative »Energieeffiziente Gebäude« Holger LöschMitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung
3 Die Bundesregierung hat für den Gebäudesektor, verantwortlich für etwa 40 Prozent des Energiever-brauchs, ambitionierte Einsparziele festgelegt. Tatsächlich sind die Energieeffizienzpotenziale im Gebäudebereich – gerade im Vergleich zu anderen Sektoren – besonders groß und in 90 Prozent aller Fälle wirtschaftlich zu heben. Damit wird deutlich, dass Gebäuden eine entschei-dende Bedeutung im Hinblick auf die Neuaus-richtung der deutschen Energie- und Klimapolitik zukommen muss. Der BDI unterstützt die beschlos-sene Energiewende ausdrücklich, erwartet jedoch, dass diese nun professionell umgesetzt wird, um unsere Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern bzw. neu zu schaffen. Die jährliche Sanierungsquote von Bestandsgebäu-den liegt heute bei nur knapp einem Prozent. Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäude-bestands bis zum Jahr 2050 zu erreichen, müssen wir schnell handeln. Es bedarf eines langfristig angelegten Gesamtkonzepts zur freiwilligen Mo-tivation der Investoren in Deutschland. Nur so ist eine Verdoppelung der Sanierungsquote sowohl bei Wohn- wie bei Nichtwohngebäuden erreich-bar. Bliebe es beim Status quo, so würden nicht nur die Ziele im Gebäudebereich unerreichbar bleiben; auch der erfolgreiche Vollzug der Energiewende ins-gesamt würde noch stärker in Gefahr geraten. Der Bestand im Gebäudesektor ist sehr vielschich-tig und daher individuell zu betrachten. Viele Mil-lionen Gebäudeeigentümer in Deutschland sind zudem verunsichert und haben Informations-defizite. Es ist bisher nicht gelungen, die dringend notwendige Sanierungswelle auszulösen. Im Ge-genteil: Der Gebäudesektor verharrt im Stillstand. Dies ist besonders ärgerlich, da durch energetische Sanierungen am Ende alle profitieren können: Eigentümer und Investoren, Mieter und Vermieter, Klima und Umwelt. Die BDI-Initiative » Energieeffiziente Gebäude« ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und wissenschaftlichen Instituten, der das Ziel verfolgt, das Thema Energie-effizienz bei Gebäuden umfassend zu diskutieren, Rahmenbedingungen mitzugestalten und prakti-sche Wege zu einer erfolgreichen Energiewende auf-zuzeigen. Mit dem vorliegenden Faktencheck Gebäude energieeffizienz wollen wir gängige Aussagen – und teilweise Irrtümer – zu diesem Thema klarstellen und einen konstruktiven Beitrag zu öffentlichen Diskussion liefern. BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz Deutschland zukunftsfähig machen: »Energieeffizienz bei Gebäuden« als Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende Vorwort Dr. Matthias HenselVorsitzender derBDI-Initiative »Energieeffiziente Gebäude« Holger LöschMitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 4 Inhalt Deutschland zukunftsfähig machen: »Energieeffizienz bei Gebäuden« als Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende ............................................................. 03 Inhalt .................................................................................................................................... 04 Ist-Zustand .......................................................................................................................... 05 Ziele ..................................................................................................................................... 06 Energiewende ...................................................................................................................... 07 Potenziale ............................................................................................................................ 08 Wirtschaftlichkeit ................................................................................................................. 09 Neu- und Altbau .................................................................................................................. 10 Energieeffizienz in allen Bereichen ...................................................................................... 11 Szenario ............................................................................................................................... 12 Klimaschutz ......................................................................................................................... 13 Technologien ....................................................................................................................... 14 Nebeneffekte ....................................................................................................................... 15 Wirtschaftlichkeit ................................................................................................................. 16 Status-Quo .......................................................................................................................... 17 Gebäudetypen ..................................................................................................................... 18 Förderung ............................................................................................................................ 19 Investitionsbereitschaft ....................................................................................................... 20 Beratung .............................................................................................................................. 21 Investor-Nutzer-Dilemma ..................................................................................................... 22 Ästhetik ................................................................................................................................ 23 Energiespar-Contracting ..................................................................................................... 24 Impressum ........................................................................................................................... 25
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 4 Inhalt Deutschland zukunftsfähig machen: »Energieeffizienz bei Gebäuden« als Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende ............................................................. 03 Inhalt .................................................................................................................................... 04 Ist-Zustand .......................................................................................................................... 05 Ziele ..................................................................................................................................... 06 Energiewende ...................................................................................................................... 07 Potenziale ............................................................................................................................ 08 Wirtschaftlichkeit ................................................................................................................. 09 Neu- und Altbau .................................................................................................................. 10 Energieeffizienz in allen Bereichen ...................................................................................... 11 Szenario ............................................................................................................................... 12 Klimaschutz ......................................................................................................................... 13 Technologien ....................................................................................................................... 14 Nebeneffekte ....................................................................................................................... 15 Wirtschaftlichkeit ................................................................................................................. 16 Status-Quo .......................................................................................................................... 17 Gebäudetypen ..................................................................................................................... 18 Förderung ............................................................................................................................ 19 Investitionsbereitschaft ....................................................................................................... 20 Beratung .............................................................................................................................. 21 Investor-Nutzer-Dilemma ..................................................................................................... 22 Ästhetik ................................................................................................................................ 23 Energiespar-Contracting ..................................................................................................... 24 Impressum ........................................................................................................................... 25
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 5 Relative Häufigkeit in % 14 12 6 10 4 8 2 0 100 0 500 300 700 200 600 400 kWh/(m2a) Gebäude mit EnEV-Standard oder besser EnEV-Standard 2009 Jahresendeenergieverbrauch Gebäude, die den EnEV-Standard nicht erfüllen Ca. 80 Prozent des Bestandes in Deutschland liegt über EnEV-Niveau (“Effizienzhaus 100“) 20% 80% Quelle: Forschungszentrum Jülich Ist-Zustand Sind die Gebäude in Deutschland durchschnittlich in einem guten Zustand? Antwort: Nein! • Ein Großteil des deutschen und eu-ropäischen Gebäudebestands ent-spricht nicht dem heutigen Stand der Technik und verbraucht daher zum Teil deutlich mehr Energie als nötig. • Weniger als 5 Prozent des Wohnge-bäudebestands sind in Bezug auf den Primärenergiebedarf so energieeffi-zient wie ein heutiger Neubau nach EnEV 2009 (mit ca. 50 kWh/m 2 und Jahr). Ähnliches gilt näherungsweise für Nichtwohngebäude. • Die 1. Wärmeschutzverordnung (Vorgängerin der EnEV) trat erst 1977 in Kraft. Viele Gebäude in Deutschland wurden jedoch in der Nachkriegszeit erstellt und stammen aus den 1950er und 1960er Jahren. • Damit unterlagen sie beim Bau kei-nen energetischen Anforderungen und müssen als dringend sanierungs-bedürftig eingestuft werden.
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 5 Relative Häufigkeit in % 14 12 6 10 4 8 2 0 100 0 500 300 700 200 600 400 kWh/(m2a) Gebäude mit EnEV-Standard oder besser EnEV-Standard 2009 Jahresendeenergieverbrauch Gebäude, die den EnEV-Standard nicht erfüllen Ca. 80 Prozent des Bestandes in Deutschland liegt über EnEV-Niveau (“Effizienzhaus 100“) 20% 80% Quelle: Forschungszentrum Jülich Ist-Zustand Sind die Gebäude in Deutschland durchschnittlich in einem guten Zustand? Antwort: Nein! • Ein Großteil des deutschen und eu-ropäischen Gebäudebestands ent-spricht nicht dem heutigen Stand der Technik und verbraucht daher zum Teil deutlich mehr Energie als nötig. • Weniger als 5 Prozent des Wohnge-bäudebestands sind in Bezug auf den Primärenergiebedarf so energieeffi-zient wie ein heutiger Neubau nach EnEV 2009 (mit ca. 50 kWh/m 2 und Jahr). Ähnliches gilt näherungsweise für Nichtwohngebäude. • Die 1. Wärmeschutzverordnung (Vorgängerin der EnEV) trat erst 1977 in Kraft. Viele Gebäude in Deutschland wurden jedoch in der Nachkriegszeit erstellt und stammen aus den 1950er und 1960er Jahren. • Damit unterlagen sie beim Bau kei-nen energetischen Anforderungen und müssen als dringend sanierungs-bedürftig eingestuft werden.
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 6 Primärenergiebedarf in % 100 80 40 60 20 0 2010 2020 2050 Jahr -80% Primärenergiebedarf -20% Wärmebedarf Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung Antwort: Ja! • Die Bundesregierung plant »bei wett-bewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau eine der energieeffizientesten und umwelt-schonendsten Volkswirtschaften der Welt« zu schaffen. • Im Gebäudebereich soll der Wärme-energieverbrauch mit einer Minde-rungsquote von 20 % bis zum Jahr 2020 starten. Bis 2050 soll eine Pri-märenergieeinsparung von 80 % er-reicht werden. • Diese Ziele sind nicht nur sehr an-spruchsvoll, sondern erfordern die Erschließung grundsätzlich neuer Wege bei der energetischen Gebäu-desanierung. • Der BDI begrüßt, dass die Bundesre-gierung den Stellenwert des Gebäu-debereichs zur Erfüllung der von ihr gesetzten Klimaschutzziele bestätigt hat und möchte mit seiner Initiative »Energieeffiziente Gebäude« aktiv daran mitarbeiten, attraktive Rah-menbedingungen zu gestalten. Ziele Bekennt sich die deutsche Industrie zu den ambitionierten Zielen im Gebäudesektor?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 6 Primärenergiebedarf in % 100 80 40 60 20 0 2010 2020 2050 Jahr -80% Primärenergiebedarf -20% Wärmebedarf Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung Antwort: Ja! • Die Bundesregierung plant »bei wett-bewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau eine der energieeffizientesten und umwelt-schonendsten Volkswirtschaften der Welt« zu schaffen. • Im Gebäudebereich soll der Wärme-energieverbrauch mit einer Minde-rungsquote von 20 % bis zum Jahr 2020 starten. Bis 2050 soll eine Pri-märenergieeinsparung von 80 % er-reicht werden. • Diese Ziele sind nicht nur sehr an-spruchsvoll, sondern erfordern die Erschließung grundsätzlich neuer Wege bei der energetischen Gebäu-desanierung. • Der BDI begrüßt, dass die Bundesre-gierung den Stellenwert des Gebäu-debereichs zur Erfüllung der von ihr gesetzten Klimaschutzziele bestätigt hat und möchte mit seiner Initiative »Energieeffiziente Gebäude« aktiv daran mitarbeiten, attraktive Rah-menbedingungen zu gestalten. Ziele Bekennt sich die deutsche Industrie zu den ambitionierten Zielen im Gebäudesektor?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 7 Antwort: Nein! • Dem Gebäudesektor kommt hin-sichtlich der Umsetzung der Ener-giewende eine Schlüsselstellung zu. Ohne eine signifikante Steigerung der Energieeffizienz in diesem Be-reich rücken die gesteckten Ziele der Bundesregierung in weite Ferne. • Neben den weiteren Themen wie Netz- und Kraftwerksausbau, Er-neuerbare Energien und Energiefor-schung wurde dem Gebäudesektor bisher zu wenig Bedeutung beige-messen. • Unsere Gebäude sind derzeit große Energiekonsumenten, obwohl es schon heute möglich wäre, den Ge-bäudebestand nahezu Klimaneutral – also ohne Ausstoß von Treibhaus-gasen – zu gestalten. • Die Energie, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht erzeugt wer-den. Damit lässt erst die Steigerung der Energieeffizienz die Umstellung unserer Energieversorgung realis-tisch werden. Energiewende Kann die Energiewende ohne eine Stärkung des Gebäudesektors gelingen? Energiewende Ener gieef fizienz Ener gief or schung Er neuerbar e Kr af tw er ksausbau Netzausbau
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 7 Antwort: Nein! • Dem Gebäudesektor kommt hin-sichtlich der Umsetzung der Ener-giewende eine Schlüsselstellung zu. Ohne eine signifikante Steigerung der Energieeffizienz in diesem Be-reich rücken die gesteckten Ziele der Bundesregierung in weite Ferne. • Neben den weiteren Themen wie Netz- und Kraftwerksausbau, Er-neuerbare Energien und Energiefor-schung wurde dem Gebäudesektor bisher zu wenig Bedeutung beige-messen. • Unsere Gebäude sind derzeit große Energiekonsumenten, obwohl es schon heute möglich wäre, den Ge-bäudebestand nahezu Klimaneutral – also ohne Ausstoß von Treibhaus-gasen – zu gestalten. • Die Energie, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht erzeugt wer-den. Damit lässt erst die Steigerung der Energieeffizienz die Umstellung unserer Energieversorgung realis-tisch werden. Energiewende Kann die Energiewende ohne eine Stärkung des Gebäudesektors gelingen? Energiewende Ener gieef fizienz Ener gief or schung Er neuerbar e Kr af tw er ksausbau Netzausbau
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 8 2% 22% 37% 1% 0,3% 0 Inform./Komm.technologie mechanische Energie(inkl. Verkehr) Prozesskälte sonstige Prozesswärme Beleuchtung Klimakälte Warmwasser ca. 40% Raumwärme Quelle: BMWi Energiedaten 2012 Fast 40 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich Antwort: Ja! • Über 40 Prozent des Primärenergie-verbrauchs in Deutschland wie der EU entfallen auf den Betrieb von Ge-bäuden. Rund 140 Terawattstunden Strom haben alle deutschen Atom-kraftwerke im Jahr 2010 produziert. Das wirtschaftliche Einsparpoten-zial durch energieeffizientere Ge-bäude ist um ein Vielfaches höher. • Rund 65 Prozent der Fassaden sind ungedämmt, weitere 20 Prozent ent-sprechen nicht dem Stand der Tech-nik. • Gleiches gilt für die Anlagentechnik: 70 Prozent bis 80 Prozent sind nicht auf dem Stand der Technik und da-mit zu einem großen Teil dringend sanierungsbedürftig. • Die BDI-Klimastudie rechnet vor, dass sich mit den verfügbaren Tech-nologien im Gebäudebereich 63 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen lassen bis 2020. 90 Pro-zent aller identifizierten Maßnah-men sind dazu noch aus Sicht der potenziellen Entscheider wirtschaft-lich, wenn der gesamte Lebenszyklus in die Betrachtung einbezogen wird. Potenziale Liegen im Gebäudesektor nennenswerte Einsparpotenziale?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 8 2% 22% 37% 1% 0,3% 0 Inform./Komm.technologie mechanische Energie(inkl. Verkehr) Prozesskälte sonstige Prozesswärme Beleuchtung Klimakälte Warmwasser ca. 40% Raumwärme Quelle: BMWi Energiedaten 2012 Fast 40 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich Antwort: Ja! • Über 40 Prozent des Primärenergie-verbrauchs in Deutschland wie der EU entfallen auf den Betrieb von Ge-bäuden. Rund 140 Terawattstunden Strom haben alle deutschen Atom-kraftwerke im Jahr 2010 produziert. Das wirtschaftliche Einsparpoten-zial durch energieeffizientere Ge-bäude ist um ein Vielfaches höher. • Rund 65 Prozent der Fassaden sind ungedämmt, weitere 20 Prozent ent-sprechen nicht dem Stand der Tech-nik. • Gleiches gilt für die Anlagentechnik: 70 Prozent bis 80 Prozent sind nicht auf dem Stand der Technik und da-mit zu einem großen Teil dringend sanierungsbedürftig. • Die BDI-Klimastudie rechnet vor, dass sich mit den verfügbaren Tech-nologien im Gebäudebereich 63 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen lassen bis 2020. 90 Pro-zent aller identifizierten Maßnah-men sind dazu noch aus Sicht der potenziellen Entscheider wirtschaft-lich, wenn der gesamte Lebenszyklus in die Betrachtung einbezogen wird. Potenziale Liegen im Gebäudesektor nennenswerte Einsparpotenziale?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 9 Quelle: dena, dpa, Statistische Landesämter, BDEW, 2012 unsaniert optimal saniert 100.000 80.000 40.000 60.000 20.000 70.000 107.000 0 In 20 Jahren In 15 Jahren In 10 Jahren Heizkosten summiert in Euro 8.000 14.000 21.000 Heizkosten im Einfamilienhaus Vergleich saniert und unsaniert 41.000 Antwort: Ja! • Die energetische Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern rechnet sich – sowohl für Vermieter als auch für Mieter. Durch eine Sanierung lassen sich meist über 80 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs ein-sparen. • Bis zu dem energetischen Standard »Effizienzhaus 70« können sanie-rungsbedürftige Mehrfamilienhäuser warmmietenneutral saniert werden. Das heißt: Der Vermieter kann die Investitionskosten rentabel auf die Kaltmiete umlegen. Der Mieter pro-fitiert gleichzeitig von geringeren Heizkosten, sodass die Warmmiete – also das, was der Mieter letztendlich zahlt – nicht steigt. • Voraussetzung hierfür sind die Kopplung der energetischen Maß-nahmen mit sowieso anstehenden Modernisierungs- und Instandhal-tungsarbeiten sowie eine gute Pla-nung, Ausführung und strategische Bewertung des Gebäudes. • Zwingend notwendig ist darüber hi-naus eine effektive staatliche Förde-rung. Wirtschaftlichkeit Können energetische Gebäudesanierungen wirtschaftlich umgesetzt werden?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 9 Quelle: dena, dpa, Statistische Landesämter, BDEW, 2012 unsaniert optimal saniert 100.000 80.000 40.000 60.000 20.000 70.000 107.000 0 In 20 Jahren In 15 Jahren In 10 Jahren Heizkosten summiert in Euro 8.000 14.000 21.000 Heizkosten im Einfamilienhaus Vergleich saniert und unsaniert 41.000 Antwort: Ja! • Die energetische Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern rechnet sich – sowohl für Vermieter als auch für Mieter. Durch eine Sanierung lassen sich meist über 80 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs ein-sparen. • Bis zu dem energetischen Standard »Effizienzhaus 70« können sanie-rungsbedürftige Mehrfamilienhäuser warmmietenneutral saniert werden. Das heißt: Der Vermieter kann die Investitionskosten rentabel auf die Kaltmiete umlegen. Der Mieter pro-fitiert gleichzeitig von geringeren Heizkosten, sodass die Warmmiete – also das, was der Mieter letztendlich zahlt – nicht steigt. • Voraussetzung hierfür sind die Kopplung der energetischen Maß-nahmen mit sowieso anstehenden Modernisierungs- und Instandhal-tungsarbeiten sowie eine gute Pla-nung, Ausführung und strategische Bewertung des Gebäudes. • Zwingend notwendig ist darüber hi-naus eine effektive staatliche Förde-rung. Wirtschaftlichkeit Können energetische Gebäudesanierungen wirtschaftlich umgesetzt werden?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 10 500 600 700 400 200 300 100 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Entwicklung WG Raumwärme+ Warmwasser-Bedarf (GWh) Jahr Quelle: Öko-Institut e. V. 2012 Energiebedarf Neubau Neubau mit Baujahr nach 2010 Gebäudebestand mit Baujahr vor 2010, saniert(ab 2005) Gebäudebestand mit Baujahr vor 2010, unsaniert Energiebedarf sanierter Bestand Energiebedarf unsanierter Bestand Neubau und Bestand von Wohngebäuden – Anteile am Energiebedarf (Szenario) Den größten Anteil zur Senkung des Energiebedarfs liefert die Sanierung von Bestandsgebäuden Antwort: Ja! • Über 90 % des Gesamtenergiebe-darfs bei Gebäuden entfällt auf den Betrieb von Gebäuden aus dem Jahr 2005 und früher. • Die gesteckten Ziele zur Reduzie-rung des Energiebedarfs können folglich nur über eine energetische Sanierung der bereits bestehenden Gebäude erreicht werden. Die tech-nologischen Lösungen hierzu sind bereits heute verfügbar. • Dennoch sind Neubauten nicht zu vernachlässigen, denn ihnen kommt eine wichtige Vorbildfunktion zu. Durch sie wird deutlich, dass mo-derne Gebäude nur noch einen minimalen Energiebedarf haben. Teilweise produzieren sie sogar mehr Energie als sie verbrauchen. • Vor allem die Sanierung öffentlicher Gebäude kann wichtige Leuchtturm-projekte schaffen, die privaten Inves-toren als Vorbild dienen. Neu- und Altbau Liegen wirklich im Gebäudebestand die größten Potenziale?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 10 500 600 700 400 200 300 100 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Entwicklung WG Raumwärme+ Warmwasser-Bedarf (GWh) Jahr Quelle: Öko-Institut e. V. 2012 Energiebedarf Neubau Neubau mit Baujahr nach 2010 Gebäudebestand mit Baujahr vor 2010, saniert(ab 2005) Gebäudebestand mit Baujahr vor 2010, unsaniert Energiebedarf sanierter Bestand Energiebedarf unsanierter Bestand Neubau und Bestand von Wohngebäuden – Anteile am Energiebedarf (Szenario) Den größten Anteil zur Senkung des Energiebedarfs liefert die Sanierung von Bestandsgebäuden Antwort: Ja! • Über 90 % des Gesamtenergiebe-darfs bei Gebäuden entfällt auf den Betrieb von Gebäuden aus dem Jahr 2005 und früher. • Die gesteckten Ziele zur Reduzie-rung des Energiebedarfs können folglich nur über eine energetische Sanierung der bereits bestehenden Gebäude erreicht werden. Die tech-nologischen Lösungen hierzu sind bereits heute verfügbar. • Dennoch sind Neubauten nicht zu vernachlässigen, denn ihnen kommt eine wichtige Vorbildfunktion zu. Durch sie wird deutlich, dass mo-derne Gebäude nur noch einen minimalen Energiebedarf haben. Teilweise produzieren sie sogar mehr Energie als sie verbrauchen. • Vor allem die Sanierung öffentlicher Gebäude kann wichtige Leuchtturm-projekte schaffen, die privaten Inves-toren als Vorbild dienen. Neu- und Altbau Liegen wirklich im Gebäudebestand die größten Potenziale?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 11 weder/noch überhaupt nicht wichtig weniger wichtig 4 % 3 % 8 % 8% 2011 86% sehr wichtig wichtig 40 % 46 % Bedeutung von Energieeffizienz in deutschen Industrieunternehmen Quelle: dena Umfrage Nov. 2011 Antwort: Nein! • Die Ziele der Energiewende können nur dann erreicht werden, wenn alle Sektoren Ihren Beitrag leisten, ne-ben dem Gebäudebereich also auch die Sektoren Industrie und Mobili-tät. • Deutsche Industrieunternehmen sind bereits heute weltweit führend im Bereich der Energieeffizienz. 86 % der Industrieunternehmen be-werten das Thema mittlerweile als wichtig, 58 % der Unternehmen ha-ben in den letzten beiden Jahren Energieeffizienzmaßnahmen durch-geführt. Quelle: dena Umfrage Nov. 2011 • Im Gebäudesektor ruhen jedoch die größten noch ungenutzten Einspar-potenziale. Ein Großteil dieser ist zudem auf wirtschaftliche Art und Weise zu heben. Dies ist in anderen Sektoren so nicht gegeben. Quelle: BDI/McKinsey Studie Energieeffizienz in allen Bereichen Reicht die Energieeffizienzsteigerung bei Gebäuden aus?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 11 weder/noch überhaupt nicht wichtig weniger wichtig 4 % 3 % 8 % 8% 2011 86% sehr wichtig wichtig 40 % 46 % Bedeutung von Energieeffizienz in deutschen Industrieunternehmen Quelle: dena Umfrage Nov. 2011 Antwort: Nein! • Die Ziele der Energiewende können nur dann erreicht werden, wenn alle Sektoren Ihren Beitrag leisten, ne-ben dem Gebäudebereich also auch die Sektoren Industrie und Mobili-tät. • Deutsche Industrieunternehmen sind bereits heute weltweit führend im Bereich der Energieeffizienz. 86 % der Industrieunternehmen be-werten das Thema mittlerweile als wichtig, 58 % der Unternehmen ha-ben in den letzten beiden Jahren Energieeffizienzmaßnahmen durch-geführt. Quelle: dena Umfrage Nov. 2011 • Im Gebäudesektor ruhen jedoch die größten noch ungenutzten Einspar-potenziale. Ein Großteil dieser ist zudem auf wirtschaftliche Art und Weise zu heben. Dies ist in anderen Sektoren so nicht gegeben. Quelle: BDI/McKinsey Studie Energieeffizienz in allen Bereichen Reicht die Energieeffizienzsteigerung bei Gebäuden aus?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 12 Wärmeenergiebedarf [p.a. in TWh] Wärmeenergieeinsparung 951 184 TWh CO2-Einsparung (~0.25 kg pro KWh) 46 Mio. t Kosteneinsparung(~9 Cent pro KWh) Einsparung [TWh] 2010 2020 Wärmeenergiebedarf in Gebäuden (Szenario 3%-Sanierung) 17 Mrd. EUR -19% 184 2010 vs. 2020 767 Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz 2011 Antwort: Ja! • Gelänge es, eine jährliche Sanie-rungsquote in Höhe von 3 Prozent zu erreichen, so würde dies sofort eine Reihe positiver Effekte nach sich zie-hen. • Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Jahren könnten jeweils ca. 184 TWh eingespart werden. Dies entspricht etwa dem Wärmeener-giebedarf von 10 Mio. Haushalten in Deutschland p.a. • Die CO 2 -Einsparung (bei 0.25 kg pro KWh) läge bei ca. 46 Mio. t. Dies ent-spricht etwa dem Ausstoß von drei durchschnittlichen deutschen Kohle-kraftwerken in Deutschland p.a. • Die Kostenersparnis läge bei ca. 17 Mrd. Euro p.a (bei 9 Cent pro KWh). Dies entspricht etwa den jähr-lichen Ausgaben für Wärmeenergie in ganz Nordrhein-Westfalen. Szenario Würde eine Erhöhung der Sanierungsquote auf 3 Prozent den Energiebedarf im Gebäude signifikant senken?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 12 Wärmeenergiebedarf [p.a. in TWh] Wärmeenergieeinsparung 951 184 TWh CO2-Einsparung (~0.25 kg pro KWh) 46 Mio. t Kosteneinsparung(~9 Cent pro KWh) Einsparung [TWh] 2010 2020 Wärmeenergiebedarf in Gebäuden (Szenario 3%-Sanierung) 17 Mrd. EUR -19% 184 2010 vs. 2020 767 Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz 2011 Antwort: Ja! • Gelänge es, eine jährliche Sanie-rungsquote in Höhe von 3 Prozent zu erreichen, so würde dies sofort eine Reihe positiver Effekte nach sich zie-hen. • Innerhalb einer Zeitspanne von 10 Jahren könnten jeweils ca. 184 TWh eingespart werden. Dies entspricht etwa dem Wärmeener-giebedarf von 10 Mio. Haushalten in Deutschland p.a. • Die CO 2 -Einsparung (bei 0.25 kg pro KWh) läge bei ca. 46 Mio. t. Dies ent-spricht etwa dem Ausstoß von drei durchschnittlichen deutschen Kohle-kraftwerken in Deutschland p.a. • Die Kostenersparnis läge bei ca. 17 Mrd. Euro p.a (bei 9 Cent pro KWh). Dies entspricht etwa den jähr-lichen Ausgaben für Wärmeenergie in ganz Nordrhein-Westfalen. Szenario Würde eine Erhöhung der Sanierungsquote auf 3 Prozent den Energiebedarf im Gebäude signifikant senken?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 13 250 200 100 150 50 0 [kWh/(m2a)] Quelle: dena, 2012 1918 und davo r 1919-194 8 1949-197 8 1979-199 0 1991-200 0 2001-200 4 2005-200 8 ab 2009 300 Durchschnitt Endenergiebedarf Durchschnitt Primärenergiebedarf End- und Primärenergiebedarf nach Baualter (Durchschnittswerte) Jahr Antwort: Ja! • Der durchschnittliche End- und Pri-märenergieverbrauch von heutigen Gebäuden beträgt nicht einmal mehr ein Viertel des Verbrauchs von Vor-kriegsgebäuden. • Es ist heute technisch schon möglich, Gebäude zu bauen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen (»Plus-energiehäuser«) • Der Energieverbrauch von Bestands-gebäuden kann durch eine ganzheit-liche energetische Sanierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik um ca. 80 Prozent gesenkt werden. • Selbst Gebäude, die nach der Einfüh-rung der 1. Wärmeschutzverordnung gebaut wurden, sind nach heutigem Stand der Technik veraltet und ver-brauchen im Vergleich zu modernen Gebäuden ein Vielfaches an Energie. Klimaschutz Sind modern ausgestattete Gebäude wirklich klimaschonender?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 13 250 200 100 150 50 0 [kWh/(m2a)] Quelle: dena, 2012 1918 und davo r 1919-194 8 1949-197 8 1979-199 0 1991-200 0 2001-200 4 2005-200 8 ab 2009 300 Durchschnitt Endenergiebedarf Durchschnitt Primärenergiebedarf End- und Primärenergiebedarf nach Baualter (Durchschnittswerte) Jahr Antwort: Ja! • Der durchschnittliche End- und Pri-märenergieverbrauch von heutigen Gebäuden beträgt nicht einmal mehr ein Viertel des Verbrauchs von Vor-kriegsgebäuden. • Es ist heute technisch schon möglich, Gebäude zu bauen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen (»Plus-energiehäuser«) • Der Energieverbrauch von Bestands-gebäuden kann durch eine ganzheit-liche energetische Sanierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik um ca. 80 Prozent gesenkt werden. • Selbst Gebäude, die nach der Einfüh-rung der 1. Wärmeschutzverordnung gebaut wurden, sind nach heutigem Stand der Technik veraltet und ver-brauchen im Vergleich zu modernen Gebäuden ein Vielfaches an Energie. Klimaschutz Sind modern ausgestattete Gebäude wirklich klimaschonender?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 14 Quelle: Umweltbundesamt, 2012 250 200 100 150 50 -50 0 Primärenergiebedarf (kWh/m2a) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Jahr 300 Stand der Forschung Baupraxis Mindestanforderungen (WSVO/EnEV) Solarhäuser Niedrigenergiehäuser 3-Liter-Häuser Nullenergiehäuser Plusenergiehäuser Antwort: Ja! • Die Historie zeigt, dass die Bau-praxis der jeweiligen gesetzlichen Mindestanforderung stets deutlich voraus war. (vgl. rote und schwarze Kurve) • Im Gebäudebereich gilt die Beson-derheit, dass alle notwendigen tech-nologischen Systeme zur Umsetzung der Energieeinsparziele bereits heute vorhanden sind. • Technisch wäre die klimaneutrale Gestaltung des Gebäudebestands in Deutschland also mit heute ver-fügbaren Technologien und Dienst-leistungen umsetzbar. Die deutsche Industrie ist nach wie vor Welt-marktführer bei klimaschützenden Technologien. Technologien Ist eine Energieeinsparung von im Durchschnitt 80 Prozent technisch umsetzbar?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 14 Quelle: Umweltbundesamt, 2012 250 200 100 150 50 -50 0 Primärenergiebedarf (kWh/m2a) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Jahr 300 Stand der Forschung Baupraxis Mindestanforderungen (WSVO/EnEV) Solarhäuser Niedrigenergiehäuser 3-Liter-Häuser Nullenergiehäuser Plusenergiehäuser Antwort: Ja! • Die Historie zeigt, dass die Bau-praxis der jeweiligen gesetzlichen Mindestanforderung stets deutlich voraus war. (vgl. rote und schwarze Kurve) • Im Gebäudebereich gilt die Beson-derheit, dass alle notwendigen tech-nologischen Systeme zur Umsetzung der Energieeinsparziele bereits heute vorhanden sind. • Technisch wäre die klimaneutrale Gestaltung des Gebäudebestands in Deutschland also mit heute ver-fügbaren Technologien und Dienst-leistungen umsetzbar. Die deutsche Industrie ist nach wie vor Welt-marktführer bei klimaschützenden Technologien. Technologien Ist eine Energieeinsparung von im Durchschnitt 80 Prozent technisch umsetzbar?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 15 Quelle: Studie Forsa / vzbv 2012 – Mehrfachnennung möglich Motivation von Gebäudeeigentümern Geldanlage, Wertsteigerung Behaglichkeit / Wohnkomfort Konkrete Schäden oder Defekte Möglichkeit des Erhalts von Fördermitteln Klimaschutz / Energiewende 12% 31% Oftmals Koppelung mit Einsatz erneuerbarer Energien 39% 52% Energieeinsparung und Kostenminderung Antwort: Nein! • Der Hauptzweck einer energetischen Sanierung ist immer zuerst das Ziel, Energie einzusparen. Der deutlich verminderte Energieverbrauch senkt den Treibhausgasausstoß und schont so das Klima. • Es gibt jedoch eine Vielzahl positiver Nebeneffekte: Durch die Energieein-sparung sinken die Betriebskosten des Gebäudes. • Durch eine moderne Ausstattung steigt der Wohlfühlfaktor und die Behaglichkeit. • Nutzt man den Lebenszyklus der Elemente des jeweiligen Gebäudes, kann man bereits durch einfache Zu-satzmaßnahmen zu ohnehin anste-henden Sanierungen eine erhebliche Wertsteigerung seiner Immobilie er-reichen. • Außerdem können Sanierungen dazu genutzt werden, Gebäude barrierefrei umzugestalten. • Jeder vierte Gebäudebesitzer erwägt derzeit aus einer Kombination unter-schiedlichster Gründe eine energeti-sche Sanierung. Noch mehr Gebäude stehen turnusgemäß ohnehin zur Sa-nierung an. Diese Potenziale gilt es zu nutzen. Nebeneffekte Führt eine energetische Sanierung »nur« zu Energieeinsparung?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 15 Quelle: Studie Forsa / vzbv 2012 – Mehrfachnennung möglich Motivation von Gebäudeeigentümern Geldanlage, Wertsteigerung Behaglichkeit / Wohnkomfort Konkrete Schäden oder Defekte Möglichkeit des Erhalts von Fördermitteln Klimaschutz / Energiewende 12% 31% Oftmals Koppelung mit Einsatz erneuerbarer Energien 39% 52% Energieeinsparung und Kostenminderung Antwort: Nein! • Der Hauptzweck einer energetischen Sanierung ist immer zuerst das Ziel, Energie einzusparen. Der deutlich verminderte Energieverbrauch senkt den Treibhausgasausstoß und schont so das Klima. • Es gibt jedoch eine Vielzahl positiver Nebeneffekte: Durch die Energieein-sparung sinken die Betriebskosten des Gebäudes. • Durch eine moderne Ausstattung steigt der Wohlfühlfaktor und die Behaglichkeit. • Nutzt man den Lebenszyklus der Elemente des jeweiligen Gebäudes, kann man bereits durch einfache Zu-satzmaßnahmen zu ohnehin anste-henden Sanierungen eine erhebliche Wertsteigerung seiner Immobilie er-reichen. • Außerdem können Sanierungen dazu genutzt werden, Gebäude barrierefrei umzugestalten. • Jeder vierte Gebäudebesitzer erwägt derzeit aus einer Kombination unter-schiedlichster Gründe eine energeti-sche Sanierung. Noch mehr Gebäude stehen turnusgemäß ohnehin zur Sa-nierung an. Diese Potenziale gilt es zu nutzen. Nebeneffekte Führt eine energetische Sanierung »nur« zu Energieeinsparung?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 16 0 2009 2010 2011 Anzahl Gebäude Quelle: Eigene Berechnungen, (KfW) 2011 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Kredit Zuschuss Zusagen KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus“ Quelle: Statistisches Bundesamt, 2012 1.8 Mio. 35% 18 Mio. 65% Wohngebäude Energieverbrauch Wohngebäude Energieverbrauch Nichtwohngebäude Nichtwohngebäude Große Potenziale im Nichtwohngebäudebereich Antwort: Ja! • Der Gebäudebereich ist sehr viel-schichtig. Dem Nichtwohnge-bäudebereich kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. • Jeder Gebäudetyp und jedes Gebäude muss individuell betrachtet werden. Maßnahmen im Bereich der Gebäu-detechnik finanzieren sich über die Endenergieeinsparung und sind in der Regel immer wirtschaftlich. • Die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden hat durch ei-nen grundsätzlich höheren Energie-verbrauch einen stärkeren Hebel zur Zielerreichung. • Neuartige Lösungskonzepte wie Gebäudeautomation oder Energie-spar-Contracting können zu einer Einsparung beim Endenergiever-brauch für Wärme in Höhe von bis zu 60 Prozent führen. (Quelle: EN 15232 sowie Prof. Dr. R. Hirschberg) • Ein energieeffizienter Betrieb gerade von größeren Gebäuden ist nur durch eine hochwertige Gebäudeautoma-tion möglich, da diese den Betrieb der technischen Anlagen an die verän-derte Nutzung automatisch anpasst. Wirtschaftlichkeit Kann auch der Nichtwohngebäudebereich einen entscheidenden Beitrag leisten?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 16 0 2009 2010 2011 Anzahl Gebäude Quelle: Eigene Berechnungen, (KfW) 2011 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Kredit Zuschuss Zusagen KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus“ Quelle: Statistisches Bundesamt, 2012 1.8 Mio. 35% 18 Mio. 65% Wohngebäude Energieverbrauch Wohngebäude Energieverbrauch Nichtwohngebäude Nichtwohngebäude Große Potenziale im Nichtwohngebäudebereich Antwort: Ja! • Der Gebäudebereich ist sehr viel-schichtig. Dem Nichtwohnge-bäudebereich kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. • Jeder Gebäudetyp und jedes Gebäude muss individuell betrachtet werden. Maßnahmen im Bereich der Gebäu-detechnik finanzieren sich über die Endenergieeinsparung und sind in der Regel immer wirtschaftlich. • Die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden hat durch ei-nen grundsätzlich höheren Energie-verbrauch einen stärkeren Hebel zur Zielerreichung. • Neuartige Lösungskonzepte wie Gebäudeautomation oder Energie-spar-Contracting können zu einer Einsparung beim Endenergiever-brauch für Wärme in Höhe von bis zu 60 Prozent führen. (Quelle: EN 15232 sowie Prof. Dr. R. Hirschberg) • Ein energieeffizienter Betrieb gerade von größeren Gebäuden ist nur durch eine hochwertige Gebäudeautoma-tion möglich, da diese den Betrieb der technischen Anlagen an die verän-derte Nutzung automatisch anpasst. Wirtschaftlichkeit Kann auch der Nichtwohngebäudebereich einen entscheidenden Beitrag leisten?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 17 0 2009 2010 2011 Anzahl Gebäude Quelle: Eigene Berechnungen, (KfW) 2011 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Kredit Zuschuss Zusagen KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus“ Antwort: Nein! • Der Gebäudebestand ist derzeit im-mer noch von Stillstand geprägt. Die Sanierungsquote stagniert seit Jah-ren konstant bei ca. 1 Prozent pro Jahr. • Zur Erreichung der gesteckten Ziele muss die Sanierungsquote auf min-destens 2 Prozent steigen. • Seit 2009 hat die Anzahl der KfW-Förderungen etwa im Programm »Energieeffizient Sanieren« sogar abgenommen (vgl. Grafik). • Die langwierigen öffentlichen Debat-ten um eine Neugestaltung der Rah-menbedingungen für energetische Sanierungen (z. B. um steuerliche Anreize) führen zu einer dauerhaf-ten Verunsicherung und Investiti-onszurückhaltung der Investoren. • Zudem fehlt ein expliziter Anreiz auch für Nichtwohngebäude. Ins-besondere dem öffentlichen Ge-bäudebestand kommt eine wichtige Vorbildfunktion zu. Status-Quo Ist im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz in Folge der Energiewende eine Aufbruchsstimmung festzustellen?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 17 0 2009 2010 2011 Anzahl Gebäude Quelle: Eigene Berechnungen, (KfW) 2011 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Kredit Zuschuss Zusagen KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus“ Antwort: Nein! • Der Gebäudebestand ist derzeit im-mer noch von Stillstand geprägt. Die Sanierungsquote stagniert seit Jah-ren konstant bei ca. 1 Prozent pro Jahr. • Zur Erreichung der gesteckten Ziele muss die Sanierungsquote auf min-destens 2 Prozent steigen. • Seit 2009 hat die Anzahl der KfW-Förderungen etwa im Programm »Energieeffizient Sanieren« sogar abgenommen (vgl. Grafik). • Die langwierigen öffentlichen Debat-ten um eine Neugestaltung der Rah-menbedingungen für energetische Sanierungen (z. B. um steuerliche Anreize) führen zu einer dauerhaf-ten Verunsicherung und Investiti-onszurückhaltung der Investoren. • Zudem fehlt ein expliziter Anreiz auch für Nichtwohngebäude. Ins-besondere dem öffentlichen Ge-bäudebestand kommt eine wichtige Vorbildfunktion zu. Status-Quo Ist im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz in Folge der Energiewende eine Aufbruchsstimmung festzustellen?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Anzahl Gebäude in Mio. Quelle: (DESTATIS, 2012d), (DESTATIS, 2012h). 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Seit 1994 einschließlich neuer Bundesländer und Berlin Anzahl Wohngebäude nach Gebäudeart Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Anteil am Gebäudeenergieverbrauch Der Gebäudeenergieverbrauch entspricht ca. 40 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs Quelle: BBSR, Stat. Bundesamt, 2012 Ein-/Zweifamilienhäuser 15 Mio. 3 Mio. 1 . 8 Mi o. Mehrfamilienhäuser Nichtwohngebäude 41 % 24 % 35 % Antwort: Nein! • Es gibt kein Allheilmittel zur ener-getischen Sanierung des Gebäu-debestands. Jedes Gebäude muss individuell betrachtet und entspre-chend behandelt werden. Eine ein-seitige Vorfestlegung auf bestimmte Maßnahmen ist kontraproduktiv sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der Wirksamkeit der Maßnah-men. • Ein Flughafenterminal braucht ein völlig anderes Sanierungskonzept als ein Wohnhaus; ein Einfamilienhaus muss anders saniert werden als eine Plattenbausiedlung. Erforderlich ist stets ein individueller Sanierungs-fahrplan, der auch eine schrittweise Sanierung in Betracht zieht. Aus die-sem Grunde ist eine effektive, kom-petente und vor allem unabhängige Energieberatungsstruktur von zent-raler Bedeutung. • Der große Anteil an Ein- und Zwei-familienhausbesitzern aber auch Ei-gentümer von Nichtwohngebäuden können darüber hinaus am besten über ein steuerliches Anreizsystem zur energetischen Sanierung ihrer Gebäude motiviert werden. Gebäudetypen Gibt es ein Standardkonzept zur Sanierung von Gebäuden?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Anzahl Gebäude in Mio. Quelle: (DESTATIS, 2012d), (DESTATIS, 2012h). 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Seit 1994 einschließlich neuer Bundesländer und Berlin Anzahl Wohngebäude nach Gebäudeart Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Anteil am Gebäudeenergieverbrauch Der Gebäudeenergieverbrauch entspricht ca. 40 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs Quelle: BBSR, Stat. Bundesamt, 2012 Ein-/Zweifamilienhäuser 15 Mio. 3 Mio. 1 . 8 Mi o. Mehrfamilienhäuser Nichtwohngebäude 41 % 24 % 35 % Antwort: Nein! • Es gibt kein Allheilmittel zur ener-getischen Sanierung des Gebäu-debestands. Jedes Gebäude muss individuell betrachtet und entspre-chend behandelt werden. Eine ein-seitige Vorfestlegung auf bestimmte Maßnahmen ist kontraproduktiv sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der Wirksamkeit der Maßnah-men. • Ein Flughafenterminal braucht ein völlig anderes Sanierungskonzept als ein Wohnhaus; ein Einfamilienhaus muss anders saniert werden als eine Plattenbausiedlung. Erforderlich ist stets ein individueller Sanierungs-fahrplan, der auch eine schrittweise Sanierung in Betracht zieht. Aus die-sem Grunde ist eine effektive, kom-petente und vor allem unabhängige Energieberatungsstruktur von zent-raler Bedeutung. • Der große Anteil an Ein- und Zwei-familienhausbesitzern aber auch Ei-gentümer von Nichtwohngebäuden können darüber hinaus am besten über ein steuerliches Anreizsystem zur energetischen Sanierung ihrer Gebäude motiviert werden. Gebäudetypen Gibt es ein Standardkonzept zur Sanierung von Gebäuden?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Anzahl Gebäude in Mio. Quelle: (DESTATIS, 2012d), (DESTATIS, 2012h). 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Seit 1994 einschließlich neuer Bundesländer und Berlin Anzahl Wohngebäude nach Gebäudeart Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Antwort: Ja! • Ein Großteil der Wohngebäude sind im Besitz privater Eigentümer. Diese müssen also den größten Teil der »Energiewende« schultern, die ohne effizientere Gebäude nicht realisier-bar ist. • Neben der erfolgreichen Förderung durch die KfW (und das MAP) be-darf es als zweiter Säule eines attrak-tiven steuerlichen Fördersystems. • Ein solches erreicht – nicht zuletzt aufgrund seiner psychologischen Wirkung – vor allem Millionen Ein- und Zweifamilienhauseigentümer am besten. • Die steuerliche Förderung sollte jedoch nicht auf Eigentümer von Wohngebäuden beschränkt blei-ben, sondern auch Eigentümern von Nichtwohngebäuden zugänglich sein. • Konservativen Hochrechnungen zu-folge löst ein eingesetzter Steuereuro mindestens 8 Euro an Investitionen – und damit erhebliche Steuerrück-flüsse – aus (Quelle: Berechnungen der dena). Förderung Würde ein steuerliches Anreizsystem eine spürbare Wirkung haben?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Anzahl Gebäude in Mio. Quelle: (DESTATIS, 2012d), (DESTATIS, 2012h). 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Seit 1994 einschließlich neuer Bundesländer und Berlin Anzahl Wohngebäude nach Gebäudeart Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Antwort: Ja! • Ein Großteil der Wohngebäude sind im Besitz privater Eigentümer. Diese müssen also den größten Teil der »Energiewende« schultern, die ohne effizientere Gebäude nicht realisier-bar ist. • Neben der erfolgreichen Förderung durch die KfW (und das MAP) be-darf es als zweiter Säule eines attrak-tiven steuerlichen Fördersystems. • Ein solches erreicht – nicht zuletzt aufgrund seiner psychologischen Wirkung – vor allem Millionen Ein- und Zweifamilienhauseigentümer am besten. • Die steuerliche Förderung sollte jedoch nicht auf Eigentümer von Wohngebäuden beschränkt blei-ben, sondern auch Eigentümern von Nichtwohngebäuden zugänglich sein. • Konservativen Hochrechnungen zu-folge löst ein eingesetzter Steuereuro mindestens 8 Euro an Investitionen – und damit erhebliche Steuerrück-flüsse – aus (Quelle: Berechnungen der dena). Förderung Würde ein steuerliches Anreizsystem eine spürbare Wirkung haben?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 20 2,5 2 1 1,5 0,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bundesmittel in Milliarden Euro Quelle: Bund, 2010, Süddeutsche Zeitung, 2009, KfW Bundesmittel für das KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramm 1,5 1,4 0,85 2,2 1,35 0,94 1,5 1,8 Jahr Antwort: Nein! • Es fehlt an Verlässlichkeit, Planbar-keit und Sicherheit für Investoren. Angesichts der demographischen Situation (ein Großteil der Ein- und Zweifamilienhausbesitzer ist älter als 60 Jahre) (Quelle: Statistisches Bundesamt) und der hohen Investi-tionssummen sind diese Faktoren je-doch von zentraler Bedeutung. • Teilweise jährlich wechselnde Zusa-gen und Rücknahmen im Bereich der staatlichen Förderung (vgl. Grafik) führen langfristig zu Verunsicherung und hemmen Investitionen. • Gebäudeeigentümer wissen nicht, mit welchen gesetzlichen Rahmen-bedingungen sie künftig konfrontiert werden und warten deshalb lieber ab. Daher ist die Erstellung eines zielführenden, detaillierten – aber auf Freiwilligkeit basierenden – Sa-nierungsfahrplans notwendig. Investitionsbereitschaft Wird Investoren eine hinreichend attraktive Investitionskulisse geboten?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 20 2,5 2 1 1,5 0,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bundesmittel in Milliarden Euro Quelle: Bund, 2010, Süddeutsche Zeitung, 2009, KfW Bundesmittel für das KfW-CO2- Gebäudesanierungsprogramm 1,5 1,4 0,85 2,2 1,35 0,94 1,5 1,8 Jahr Antwort: Nein! • Es fehlt an Verlässlichkeit, Planbar-keit und Sicherheit für Investoren. Angesichts der demographischen Situation (ein Großteil der Ein- und Zweifamilienhausbesitzer ist älter als 60 Jahre) (Quelle: Statistisches Bundesamt) und der hohen Investi-tionssummen sind diese Faktoren je-doch von zentraler Bedeutung. • Teilweise jährlich wechselnde Zusa-gen und Rücknahmen im Bereich der staatlichen Förderung (vgl. Grafik) führen langfristig zu Verunsicherung und hemmen Investitionen. • Gebäudeeigentümer wissen nicht, mit welchen gesetzlichen Rahmen-bedingungen sie künftig konfrontiert werden und warten deshalb lieber ab. Daher ist die Erstellung eines zielführenden, detaillierten – aber auf Freiwilligkeit basierenden – Sa-nierungsfahrplans notwendig. Investitionsbereitschaft Wird Investoren eine hinreichend attraktive Investitionskulisse geboten?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 21 Quelle: Forsa Umfrage 2012 Region West Ost Repräsentative Umfrage unter Gebäudeeigentümern Haben Sie vor der Durchführung bzw. Beauftragung der energetischen Modernisierungsmaßnahmen eine Beratung in Anspruch genommen? ? Geschlecht Ja Nein Ja Nein 78 % 22 % 25 % 75 % Ja Nein 60 Jahre + 30-39 Jahre 50-59 Jahre 40-49 Jahre bis 29 Jahre 71 % 74 % 79 % 77 % 84 % 77 % 14 % 23 % 66 % 29 % 26 % 21 % 23 % 34 % Haushaltsnettoeinkommen Ja Nein bis 1.500 € 1.500 € - 3.000 € 3.500 € + 75 % 25 % 16 % 84 % Gesamt Ja Nein 76 % 24 % € € € € € € Alter 23 % 76 % Deutschland Antwort: Nein! • 84 Prozent der Deutschen erwarten steigende Energiepreise, dennoch sind die wenigsten über Einsparmög-lichkeiten angemessen informiert. Untersuchungen zeigen, dass mehr als ¾ der privaten Gebäudeeigentü-mer nicht einmal grob über den ener-getischen Zustand ihres Gebäudes informiert sind. • Dennoch haben bei bereits erfolgten Sanierungen nur 18 Prozent der Ge-bäudeeigentümer eine Energiebera-tung in Anspruch genommen. Eine Vielzahl dieser Sanierungen sind da-her nicht optimal vollzogen worden. Im Durchschnitt wurden nur 30 Pro-zent des Einsparpotenzials gehoben. • Grundvoraussetzung für jede ener-getische Maßnahme muss daher stets eine umfangreiche Bestandsauf-nahme in Form einer Energiebera-tung sein. • Wir fordern die Etablierung eines kompetenten, kostengünstigen und vor allem unabhängigen Energiebe-ratungssystems, das sich nicht auf einzelne Gewerke, sondern das Ge-bäude als Gesamtsystem bezieht. Beratung Werden Gebäudeeigentümer ausreichend beraten und informiert?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 21 Quelle: Forsa Umfrage 2012 Region West Ost Repräsentative Umfrage unter Gebäudeeigentümern Haben Sie vor der Durchführung bzw. Beauftragung der energetischen Modernisierungsmaßnahmen eine Beratung in Anspruch genommen? ? Geschlecht Ja Nein Ja Nein 78 % 22 % 25 % 75 % Ja Nein 60 Jahre + 30-39 Jahre 50-59 Jahre 40-49 Jahre bis 29 Jahre 71 % 74 % 79 % 77 % 84 % 77 % 14 % 23 % 66 % 29 % 26 % 21 % 23 % 34 % Haushaltsnettoeinkommen Ja Nein bis 1.500 € 1.500 € - 3.000 € 3.500 € + 75 % 25 % 16 % 84 % Gesamt Ja Nein 76 % 24 % € € € € € € Alter 23 % 76 % Deutschland Antwort: Nein! • 84 Prozent der Deutschen erwarten steigende Energiepreise, dennoch sind die wenigsten über Einsparmög-lichkeiten angemessen informiert. Untersuchungen zeigen, dass mehr als ¾ der privaten Gebäudeeigentü-mer nicht einmal grob über den ener-getischen Zustand ihres Gebäudes informiert sind. • Dennoch haben bei bereits erfolgten Sanierungen nur 18 Prozent der Ge-bäudeeigentümer eine Energiebera-tung in Anspruch genommen. Eine Vielzahl dieser Sanierungen sind da-her nicht optimal vollzogen worden. Im Durchschnitt wurden nur 30 Pro-zent des Einsparpotenzials gehoben. • Grundvoraussetzung für jede ener-getische Maßnahme muss daher stets eine umfangreiche Bestandsauf-nahme in Form einer Energiebera-tung sein. • Wir fordern die Etablierung eines kompetenten, kostengünstigen und vor allem unabhängigen Energiebe-ratungssystems, das sich nicht auf einzelne Gewerke, sondern das Ge-bäude als Gesamtsystem bezieht. Beratung Werden Gebäudeeigentümer ausreichend beraten und informiert?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 22 Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim 78,2 7 306 K K K W W W W h / m 2 pr p o Ja hr Verbrauch vor der Sanierung 306 KWh/m 2 pro Jahr Verbrauch nach der Sanierung 78,2 KWh/m 2 pro Jahr Fänden Sie eine energetische Sanierungwünschenswert? Welche Mieterhöhung würden Sie für die Sanierung akzeptieren? Quelle: dimap 2011 (Fachverband WDVS) Ja 74% Nein 19 % Keine Angabe 6 % Weiß nicht 1 % Keine 24% bis zur Höhe der eingesparten Heiz- und Nebenkosten 39 % Weiß nicht 5 % bis 15 % 29 % Keine Angabe bis 30 % 2 % 1 % Repräsentative Umfrage unter Gebäudeeigentümern Antwort: Ja! • Das »Investor-Nutzer Dilemma« stellt nach wie vor eines der Haupthindernisse bei energetischen Sanierungen dar. Von den insgesamt 39 Mio. Wohnungen in Deutsch-land sind circa 80 Prozent vor 1984 errichtet und bis heute weitgehend unsaniert – an Gebäudehülle und Gebäudetechnik. • Deutschland ist ein Land der Mie-ter, die Mehrheit der Wohnungen in Deutschland werden vermietet und nicht durch den Eigentümer bewohnt. • 74 Prozent der Mieter unsanierter Wohnungen wünschen sich eine energetische Modernisierung. 70 Prozent von ihnen würden dafür so-gar eine deutliche Mieterhöhung ak-zeptieren. • Derzeit hat jedoch der Vermieter stets die Kosten der Sanierung zu tragen, obwohl der Mieter durch niedrigere Nebenkosten der Haupt-nutznießer ist. • Wir fordern daher eine gerechtere Lastenverteilung, ohne dass der Mie-ter finanziell überfordert wird. • Gleiches gilt näherungsweise auch für Nichtwohngebäude. Investor-Nutzer-Dilemma Spielt das Miet- und Pachtrecht eine entscheidende Rolle bei energetischen Sanierungen?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 22 Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim 78,2 7 306 K K K W W W W h / m 2 pr p o Ja hr Verbrauch vor der Sanierung 306 KWh/m 2 pro Jahr Verbrauch nach der Sanierung 78,2 KWh/m 2 pro Jahr Fänden Sie eine energetische Sanierungwünschenswert? Welche Mieterhöhung würden Sie für die Sanierung akzeptieren? Quelle: dimap 2011 (Fachverband WDVS) Ja 74% Nein 19 % Keine Angabe 6 % Weiß nicht 1 % Keine 24% bis zur Höhe der eingesparten Heiz- und Nebenkosten 39 % Weiß nicht 5 % bis 15 % 29 % Keine Angabe bis 30 % 2 % 1 % Repräsentative Umfrage unter Gebäudeeigentümern Antwort: Ja! • Das »Investor-Nutzer Dilemma« stellt nach wie vor eines der Haupthindernisse bei energetischen Sanierungen dar. Von den insgesamt 39 Mio. Wohnungen in Deutsch-land sind circa 80 Prozent vor 1984 errichtet und bis heute weitgehend unsaniert – an Gebäudehülle und Gebäudetechnik. • Deutschland ist ein Land der Mie-ter, die Mehrheit der Wohnungen in Deutschland werden vermietet und nicht durch den Eigentümer bewohnt. • 74 Prozent der Mieter unsanierter Wohnungen wünschen sich eine energetische Modernisierung. 70 Prozent von ihnen würden dafür so-gar eine deutliche Mieterhöhung ak-zeptieren. • Derzeit hat jedoch der Vermieter stets die Kosten der Sanierung zu tragen, obwohl der Mieter durch niedrigere Nebenkosten der Haupt-nutznießer ist. • Wir fordern daher eine gerechtere Lastenverteilung, ohne dass der Mie-ter finanziell überfordert wird. • Gleiches gilt näherungsweise auch für Nichtwohngebäude. Investor-Nutzer-Dilemma Spielt das Miet- und Pachtrecht eine entscheidende Rolle bei energetischen Sanierungen?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 23 Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim 78,2 7 306 K K K W W W W h / m 2 pr p o Ja hr Verbrauch vor der Sanierung 306 KWh/m 2 pro Jahr Verbrauch nach der Sanierung 78,2 KWh/m 2 pro Jahr Antwort: Ja! • Uns stehen heute alle notwendigen technischen Mittel zur Verfügung, um historisch wertvolle Altbauten und sogar denkmalgeschützte Ge-bäude (3 Prozent des Gebäudebe-stands) energetisch zu sanieren – mit Einsparungen von durchschnittlich 75 bis 85 Prozent. • Die stadtbildprägende Ästhetik von Altbauten wird dabei gewahrt, das Erscheinungsbild der historischen Bausubstanz signifikant verbessert. Moderne Lösungskonzepte wie Lüf-tungsanlagen, effiziente Heizungen oder Innenwanddämmungen ermög-lichen trotz Denkmalschutzes hohe Energieeinsparungen. • Energetisch sanierte Altbauten ver-binden heute hervorragend Tradition und Moderne – unter gleichzeitiger Berücksichtigung klimapolitischer Erwägungen. Sie sind lebenswert und bei Ihren Bewohnern sehr be-liebt. Ästhetik Können Altbauten und denkmalgeschützte Gebäude ebenfalls auf einen energetisch optimalen Stand saniert werden?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 23 Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim Baujahr: 1921/22 | Fläche pro Haus: ca. 160qmSanierung von 83 Häusern mit 90 Wohnungen zu „Niedrigenergiehäusern“.Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und des historischen Charakters der Gebäude. Jeder Gebäudetyp muss individuell betrachtet werden Beispiel: Denkmalgeschütztes Ensemble „Aschantidorf“ in Ludwigshafen / Friesenheim 78,2 7 306 K K K W W W W h / m 2 pr p o Ja hr Verbrauch vor der Sanierung 306 KWh/m 2 pro Jahr Verbrauch nach der Sanierung 78,2 KWh/m 2 pro Jahr Antwort: Ja! • Uns stehen heute alle notwendigen technischen Mittel zur Verfügung, um historisch wertvolle Altbauten und sogar denkmalgeschützte Ge-bäude (3 Prozent des Gebäudebe-stands) energetisch zu sanieren – mit Einsparungen von durchschnittlich 75 bis 85 Prozent. • Die stadtbildprägende Ästhetik von Altbauten wird dabei gewahrt, das Erscheinungsbild der historischen Bausubstanz signifikant verbessert. Moderne Lösungskonzepte wie Lüf-tungsanlagen, effiziente Heizungen oder Innenwanddämmungen ermög-lichen trotz Denkmalschutzes hohe Energieeinsparungen. • Energetisch sanierte Altbauten ver-binden heute hervorragend Tradition und Moderne – unter gleichzeitiger Berücksichtigung klimapolitischer Erwägungen. Sie sind lebenswert und bei Ihren Bewohnern sehr be-liebt. Ästhetik Können Altbauten und denkmalgeschützte Gebäude ebenfalls auf einen energetisch optimalen Stand saniert werden?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 24 Garantiedauer Zeit Betriebskosten Die Anwendung von ganzheitlichen Systemen und Lösungskonzepten mit Gebäudeautomation– wie beispielsweise beim Energiespar-Contracting – ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg Beispiel: Energiespar-Contracting Gewinn Kunde Reduzierte Kosten Einspar-Gara rrrrrrrrrrrraaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaa rrrrrrraaaa Contracting-Rate Antwort: Nein! • Es gibt eine Vielzahl an modernen und innovativen Lösungskonzepten, die leider viel zu wenig Anwendung finden. • Modernisierungen binden oftmals zu viel Kapital, sodass sinnvolle Sa-nierungen nur zögerlich in Angriff genommen werden. Bei komplexen Versorgungsaufgaben kann bei-spielsweise das Modell des »Energie-spar-Contractings« weiterhelfen. Als Energiedienstleistung »aus einer Hand« modernisiert der Contractor auf Basis einer ganzheitlichen Be-wertung das Gebäude, garantiert den wirtschaftlichen Erfolg, setzt die Sa-nierung vollständig um, übernimmt das technische Risiko und bietet ver-schiedenen Finanzierungsmodelle an. Die Investitionen refinanzieren sich dann über die Energieeinspa-rungen. • Mit Energiespar-Contracting sind nachweislich Einsparungen von 30 bis 40 Prozent der Jahresenergie-kosten über Zeitperioden von 5 bis 15 Jahre realisierbar und durch die Garantie eine feste kalkulatorische Größe in der Finanzplanung des Be-treibers. • Deutschlandweit ließen sich dadurch jährlich Energiekosten in Höhe von 800 Millionen EURO vermeiden. Energiespar-Contracting Finden neuartige Lösungskonzepte ausreichend Anwendung?
BDI-Bundesverband der Deutschen IndustrieFaktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 24 Garantiedauer Zeit Betriebskosten Die Anwendung von ganzheitlichen Systemen und Lösungskonzepten mit Gebäudeautomation– wie beispielsweise beim Energiespar-Contracting – ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg Beispiel: Energiespar-Contracting Gewinn Kunde Reduzierte Kosten Einspar-Gara rrrrrrrrrrrraaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaa rrrrrrraaaa Contracting-Rate Antwort: Nein! • Es gibt eine Vielzahl an modernen und innovativen Lösungskonzepten, die leider viel zu wenig Anwendung finden. • Modernisierungen binden oftmals zu viel Kapital, sodass sinnvolle Sa-nierungen nur zögerlich in Angriff genommen werden. Bei komplexen Versorgungsaufgaben kann bei-spielsweise das Modell des »Energie-spar-Contractings« weiterhelfen. Als Energiedienstleistung »aus einer Hand« modernisiert der Contractor auf Basis einer ganzheitlichen Be-wertung das Gebäude, garantiert den wirtschaftlichen Erfolg, setzt die Sa-nierung vollständig um, übernimmt das technische Risiko und bietet ver-schiedenen Finanzierungsmodelle an. Die Investitionen refinanzieren sich dann über die Energieeinspa-rungen. • Mit Energiespar-Contracting sind nachweislich Einsparungen von 30 bis 40 Prozent der Jahresenergie-kosten über Zeitperioden von 5 bis 15 Jahre realisierbar und durch die Garantie eine feste kalkulatorische Größe in der Finanzplanung des Be-treibers. • Deutschlandweit ließen sich dadurch jährlich Energiekosten in Höhe von 800 Millionen EURO vermeiden. Energiespar-Contracting Finden neuartige Lösungskonzepte ausreichend Anwendung?
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 25 Impressum Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) Breite Straße 29 10178 Berlin E-Mail: [email protected] Internet: www.gebaeude-initiative.de Redaktion / Fachliche Erarbeitung: Daniel Schwake, Abteilung Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit 1. Auflage, September 2013
BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz 25 Impressum Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) Breite Straße 29 10178 Berlin E-Mail: [email protected] Internet: www.gebaeude-initiative.de Redaktion / Fachliche Erarbeitung: Daniel Schwake, Abteilung Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit 1. Auflage, September 2013
Faktencheck Gebäudeenergieeffizienz
Faktencheck Gebäudeenergieeffizienz