Warenkorb
0 Punkte
Händlerauswahl
Wählen Sie den Händler aus, den Sie für Ihren Einkauf nutzen möchten.
Händler

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
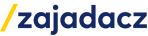
Unbekannt
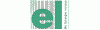
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
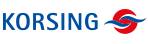
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
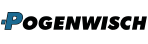
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
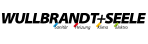
Unbekannt

Unbekannt

Unbekannt
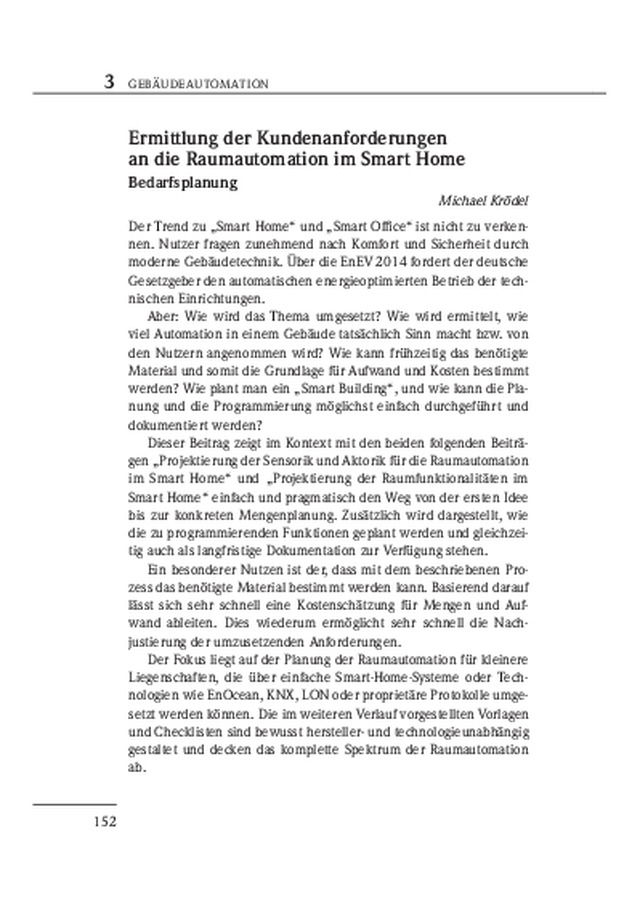

Ermittlung der Kundenanforderungen an die Raumautomation im Smart Home
Der Trend zu „Smart Home“ und „Smart Office“ ist nicht zu verkennen. Nutzer fragen zunehmend nach Komfort und Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik.
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 152 Ermittlung der Kundenanforderungen an die Raumautomation im Smart Home Bedarfsplanung Michael Krödel Der Trend zu „Smart Home“ und „Smart office“ ist nicht zu verken-nen. Nutzer fragen zunehmend nach Komfort und Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik. Über die EnEV 2014 fordert der deutsche Gesetzgeber den automatischen energieoptimierten Betrieb der tech-nischen Einrichtungen. Aber: Wie wird das Thema umgesetzt? Wie wird ermittelt, wie viel Automation in einem Gebäude tatsächlich Sinn macht bzw. von den Nutzern angenommen wird? Wie kann frühzeitig das benötigte Material und somit die Grundlage für Aufwand und Kosten bestimmt werden? Wie plant man ein „Smart Building“, und wie kann die Pla-nung und die Programmierung möglichst einfach durchgeführt und dokumentiert werden? Dieser Beitrag zeigt im Kontext mit den beiden folgenden Beiträ- gen „Projektierung der Sensorik und Aktorik für die Raumautomation im Smart Home“ und „Projektierung der Raumfunktionalitäten im Smart Home“ einfach und pragmatisch den Weg von der ersten Idee bis zur konkreten Mengenplanung. Zusätzlich wird dargestellt, wie die zu programmierenden Funktionen geplant werden und gleichzei-tig auch als langfristige Dokumentation zur Verfügung stehen. Ein besonderer Nutzen ist der, dass mit dem beschriebenen Pro- zess das benötigte Material bestimmt werden kann. Basierend darauf lässt sich sehr schnell eine Kostenschätzung für Mengen und Auf-wand ableiten. Dies wiederum ermöglicht sehr schnell die Nach- justierung der umzusetzenden Anforderungen. Der Fokus liegt auf der Planung der Raumautomation für kleinere Liegenschaften, die über einfache Smart-Home-Systeme oder Tech-nologien wie Enocean, KNX, LoN oder proprietäre Protokolle umge-setzt werden können. Die im weiteren Verlauf vorgestellten Vorlagen und Checklisten sind bewusst hersteller- und technologieunabhängig gestaltet und decken das komplette Spektrum der Raumautomation ab. jb-2016_eg.indb 152 25.08.2015 9:43:43 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 153 Für die Planung von Raumautomation in komplexeren Liegen- schaften (z. B. größere Nichtwohngebäude bzw. die ganzheitliche Pla-nung von Raum- und Anlagenautomation) stößt der Prozess an seine Grenzen. Dieser Beitrag ersetzt nicht den für diese Liegenschaften nötigen detaillierteren Planungsprozess auf Basis der Richtlinie VDI 3813, und es wird an dieser Stelle auf die entsprechend einschlägige Literatur verwiesen. Selbstverständlich können und sollten die im Folgenden behandelten Inhalte zusätzlich als Anregungen verwendet werden, da insbesondere die Bestimmung der sinnvollen Anforderun-gen auch bei den detaillierteren Planungsprozessen oft nicht ausrei-chend berücksichtigt wird. Dieser Beitrag ermittelt die Anforderungen des Kunden und leitet daraus ab, welche Raumfunktionen erforderlich sind. In dem folgen-den Beitrag „Projektierung der Sensorik und Aktorik für die Raumau-tomation im Smart Home“ wird darauf aufbauend unter Einbeziehung des Grundrissplans ermittelt, welche konkreten Komponenten erfor-derlich sind. Mit dieser Mengenplanung kann bereits eine erste Kos-tenabschätzung erfolgen. Im Beitrag „Projektierung der Raumfunk-tionalitäten im Smart Home“ erfolgt die konkrete Funktionsplanung, d. h. „welcher Sensor wirkt auf welchen Aktor“. Dies ist wichtig, um die vom Kunden gestellten Anforderungen mit möglichst wenig Auf-wand zu dokumentieren – sowohl für die konkrete Programmierung als auch für die langfristige Dokumentation. Inhaltlich orientiert sich dieser Beitrag sowie die beiden folgenden Beiträge an der IGT-Richtlinie 02: „Planung von Smarthome-Syste-men“ [IGT02]. Bei Interesse zu vertiefenden Ausführungen sowie weiteren Variationen der Planung wird auf diese Richtlinie verwie-sen. Zu allen Planungsschritten stehen Vorlagen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Der Link für den Download und weitere Informationen sind unter [2] angegeben. Klärung der Anforderungen GrundsätzlichesAm Beginn jeder Planung steht die sorgfältige Klärung der Anforde-rungen, d. h. des konkreten Bedarfs des Kunden: Was soll überhaupt automatisiert werden? Das erscheint so selbstverständlich und wird doch so regelmäßig unzureichend durchgeführt. jb-2016_eg.indb 153 25.08.2015 9:43:43 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 154 Dazu ein konkretes Beispiel: Gehen Sie einmal bei einer Messe auf den Stand eines Herstellers von Smart-Home-Produkten. In fast allen Fällen fängt man sehr schnell an, Ihnen zu zeigen, was alles möglich ist. Man redet auf Sie ein und führt Sie ungefragt zu ausgestellten Produkten oder funktionierenden Demoaufbauten, bei denen mit ir-gendwelchen Tastern nun irgendwelche Aktoren plötzlich ein- und ausgeschaltet werden. oder man zeigt Ihnen gleich eine Smartphone-App in hippem Design und bunten Farben. Auch hier wird irgendet-was angewählt, und quasi zum Beweis surrt ein Rollladenmotor, oder eine Leuchte geht auf einen Dimmwert. Warum fragt man Sie nicht vor jeglicher Information, was Sie oder Ihr Kunde überhaupt automatisiert haben möchten? Automation be-deutet die Übertragung von Arbeit: Weg vom Menschen und hin zum Automaten. Dabei hat jeder Mensch naturgemäß andere Präferenzen. Während der eine etwas ängstlicher ist und somit Sicherheitsanforde-rungen, wie z. B. Einbruchsschutz oder Rauchmelder-Überwachung favorisiert, bevorzugt ein anderer womöglich Komfortaspekte wie z. B. Raumtemperaturregelung, automatisierte Rollläden oder Licht-szenen. Warum stellen wir in den meisten Fällen nicht den Mensch und dessen Wünsche in den Mittelpunkt, sondern die Technik und ihre Möglichkeiten? In sehr vielen (zu vielen!) Fällen, wird im Ge-bäude automatisiert, ohne auf die Bedürfnisse und Wünsche des späteren Nutzers einzugehen. Man automatisiert Gebäude geradeso, als ob es den Menschen im Gebäude nicht gäbe. Wenn es aber tat-sächlich keine Menschen im Gebäude gibt, dann braucht man auch keine Gebäudeautomation: Man könnte das Licht und die Heizung ausgeschaltet und die Rollläden unten lassen. Deshalb nochmal: Der erste und ganz elementare Schritt ist die Bestimmung der sinnvollen Anforderungen. Im Groben sind das die Kategorien „Energieeffizienz“, „Sicherheit“ und „Komfort“. Zusätz-lich wären noch Anforderungen aus dem Bereich „Multimedia“ denk-bar – da diese im Vergleich zu den drei anderen Kategorien deutlich geringer nachgefragt werden, werden diese im Weiteren nicht be-rücksichtigt. Bei Bedarf sind diese also individuell aufzunehmen, d. h. entsprechend zu ergänzen. jb-2016_eg.indb 154 25.08.2015 9:43:43 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 155 VorgehenUm die Anforderungen der drei erwähnten Hauptkategorien systema-tisch so abzufragen, dass jeder Nutzer diese für sich beurteilen kann, wurde ein Fragebogen mit 48 Fragen entworfen. Alle Fragen sind so formuliert, dass diese von jedem beantwortet werden können, d. h. es sind keinerlei Kenntnisse bzgl. Gebäudetechnik oder -automation erforderlich. Der vollständige Fragebogen umfasst in der aktuellen Version 16 Seiten und ist als Download kostenlos erhältlich [2]. Der Fragebogen gliedert sich in die Teilbereiche Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Verschattung, Kühlung, Sicherheit und Weitere Anfor-derungen. Sofern ein Gewerk nicht vorliegt (z. B. Kühlung), sind die entsprechenden Fragen selbstverständlich nicht zu beantworten. Dabei ist zu beachten, dass zu jeder Frage eine differenzierte Ant- wort gegeben werden kann. Das macht deshalb Sinn, um zu erfahren, ob eine Anforderung auf jeden Fall oder nur eventuell gewünscht bzw. abgelehnt wird. Auch sollte zu jeder Anforderung angegeben werden, für welche Räume die Anforderung gewünscht wird. Für ein Wohnzimmer werden in der Regel andere, hochwertigere Anforde-rungen erhoben als z. B. für ein Gäste-WC oder einen Kellerraum. BeispielUm die Inhalte besser nachvollziehen zu können, wird parallel zur all-gemeinen Vorgehensweise ein Beispiel verwendet, welches sukzes-sive in diesem und den beiden folgenden Beiträgen weiterentwickelt wird. Um dieses Beispiel so einfach wie möglich zu halten, besteht es nur aus einem einzelnen Raum: Konkret ein Wohnzimmer mit zwei Fenstern mit je einem motorbetriebenen Rollladen. Für diesen Raum sollen die Anforderungen für die Automation der Beleuchtungs- und Verschattungseinrichtungen aufgenommen werden. Für dieses Beispiel ist der Fragebogen in Bezug auf die Teilberei- che „Beleuchtung“ und „Verschattung“ wie folgt ausgefüllt worden (siehe Bild 1 und 2). jb-2016_eg.indb 155 25.08.2015 9:43:43 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 156 Bild 1: Fragebogen Beleuchtung (Beispiel) Ich wünsche mir die Möglichkeit, das Licht von mehreren Stellen aus schalten oder dimmen zu können. So kann ich das Licht z. B. sowohl über den W andtaster als auch vom Schreibtisch oder Sofa auf die gewünschte Lichtstärke einstellen. Ich wünsche mir die Möglichkeit, mit einem normalen T aster mehrere Leuchten bzw . Leuchtengruppen auf einmal schalten oder dimmen zu können. Um Energie zu sparen, möchte ich, dass sich das Licht bei Betreten des Raumes automatisch einschaltet und danach ebenso wieder abschaltet. Damit hat die Betätigung von Lichtschaltern in Gängen und Fluren ein Ende. Die Räume sollen immer nur so stark beleuchtet werden wie nötig. Anstatt das Licht stets ganz einzuschalten, soll es immer nur so hell sein, wie es nötig ist, um den fehlenden Beleuchtungsanteil auszu- gleichen. Bestimmte Situatione brauchen bestimmte Lichtstimmungen. Deshalb will ich per T aster Lichtszenen wie „Abendessen“, „Entspannung“ etc. aufrufen können, statt jede Leuchte individuell dimmen zu müssen. Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme überhaupt nicht zu Stimme voll zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu B1 B2 B3 B4 B5 Stimme voll zu Stimme voll zu Stimme voll zu Stimme voll zu jb-2016_eg.indb 156 25.08.2015 9:43:43 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 157 Bild 2: Fragebogen V erschattung (Beispiel) Jalousien oder Rollläden sollen auf Wunsch auch gruppenweise gefahren werden können. So kann ich die V erschattung bequem für den ganzen Raum oder auch das gesamte Stockwerk ansteuern. Die Rollläden bzw . die Jalousien sollen in Abhängigkeit der Außen- helligkeit gefahren werden. So passt sich der Zeitpunkt optimal an den jahreszeitlichen V erlauf von Sonnenauf- und -untergang an. Die V erschattung soll automatisch herauf- und herunterfahren. So hat das tägliche manuelle Bedienen ein Ende. Außerdem erscheint das Gebäude bewohnt, auch wenn niemend anwesend ist. Falls ich mich auf dem Balkon oder der T errasse aufhalte, soll der Roll - laden/die Jalousie der betreffenden Tür nicht heruntergefahren werden – somit kann mich die Automation nicht aussperren. W enn ich mich im Raum befinde, sollen die V erschattungseinrichtungen nicht automatisch gefahren werden. Ich möchte das selber entscheiden – nur bei Abwesenheit übernimmt die Automation die Kontrolle. Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme voll zu Räume: Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Stimme überhaupt nicht zu V1 V2 V3 V4 V5 Stimme voll zu Stimme voll zu Stimme voll zu Stimme voll zu Stimme voll zu jb-2016_eg.indb 157 25.08.2015 9:43:44 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 158 Überführung der Anforderungen in erforderliche Sensor-, Aktor- und Verarbeitungsfunktionen GrundsätzlichesAuf Basis der gewählten Anforderungen ergeben sich unmittelbar Konsequenzen für erforderliche Sensoren und Aktoren. Dazu ein Beispiel aus dem Bereich der Heizung: Im Falle einer Raumtempe-raturregelung muss zwangsläufig die Ist-Temperatur gemessen und mit einer Soll-Temperatur verglichen werden. Diese Soll-Temperatur kommt sinnvollerweise von einem Raumbediengerät, um dem Nutzer Einfluss auf die Raumtemperatur zu ermöglichen. Die Wahl der Akto-rik hängt von der Art der Wärmeerzeugung und -übergabe im Raum ab. Man wird entweder Stellventile für die Heizkörper oder ein Stell-ventil für den Vorlauf einer Fußbodenheizung benötigen. Alternativ ist es denkbar, dass mit einem elektrischen Heizgerät geheizt wird. In diesem Fall benötigt man einen Schaltaktor. Welche und wie viele Sensoren und Aktoren im Raum benötigt werden, hängt von dem konkreten Raum/Gebäude und dessen Aus-stattung ab. Dabei muss beachtet werden, dass manche Sensoren gleichzeitig mehreren Anforderungen dienen können. Ein Präsenz-melder kann sowohl zur Lichtsteuerung (Ausschalten bei Abwesen-heit) als auch zur Heizungssteuerung (Temperaturabsenkung bei Abwesenheit) als auch zur Einbruchsüberwachung eingesetzt wer-den. Es besteht somit kein direkter Zusammenhang zwischen den Anforderungen des Fragebogens und Komponenten (Sensoren und Aktoren). Als Zwischengröße werden deshalb (Sensor-, Aktor-, Verarbei- tungs-)Funktionen eingeführt, wie sie nötig sind, um die Anforderun-gen aus dem Fragebogen zu erfüllen. Von diesen Funktionen lassen sich dann im nächsten Schritt die benötigten Sensoren und Aktoren ableiten. Im Fall einer Raumtemperaturregelung werden zunächst die Sen- sorfunktionen „Lufttemperaturmessung innen“ und „Sollwert stel-len“ sowie die Aktorfunktion „Heizungssteuerung“ benötigt. Aller-dings ist auch eine Verarbeitungsfunktion erforderlich. Der Sensor misst lediglich den Ist-Wert, und der Aktor führt lediglich aus, was ihm angetragen wird. Dazwischen muss eine Verarbeitungsfunktion entscheiden, wann welche Befehle an den Aktor gegeben werden. jb-2016_eg.indb 158 25.08.2015 9:43:44 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 159 Im hier beschriebenen Fall ist das die Verarbeitungsfunktion „Tem-peraturregelung“. VorgehenDie erwähnte Überleitung vom Fragebogen auf die benötigten Funk-tionen erfolgt mithilfe einer Checkliste. In den ersten Spalten wird der Bezug zu den Fragen des Fragebogens hergestellt (Nummerierung bzw. Inhalte der Fragen in Kurzform). In einer weiteren Spalte wird aufgeführt, welche Sensor-, Aktor- und Verarbeitungsfunktionen in Konsequenz nötig sind. Die leeren Spalten können für die jeweiligen Räume verwendet werden, d. h. es ist der Name des Raumes als Spal-tenüberschrift einzutragen. Für jeden Raum (Spalte) kann zeilenweise markiert werden, ob die dort aufgeführte Anforderung bzw. die daraus resultierenden Funktio-nen benötigt werden. BeispielFür das bereits begonnene Beispiel wurden lediglich Anforderungen an die Beleuchtung und die Verschattung gestellt. Somit ergibt sich die Checkliste wie in Tabelle 1 dargestellt. Für das vorliegende Beispiel ergeben sich in Summe die folgenden benötigten Funktionen (sortiert aus Tabelle 1, Spalte „Anforderungen an …“, zu entnehmen): Funktionen der Sensorik (FS): – Zeitprogramm (FS3) – Taster (FS8) Funktionen der Aktorik (FA): – Lichtaktor-Dimmen (FA5) – Lichtaktor-Schalten/Lichtaktor-Dimmen (FA6) – Verschattungssteuerung (FA7)Beim Betrachten dieser Auflistung ist zu erkennen, welche Sensoren und Aktoren zur Umsetzung benötigt werden. Dabei sind unterschied-liche Varianten möglich. Taster-Funktionen können über Wandtaster aber auch über Handsender umgesetzt werden. Zeitprogramme kön-nen über einen Zeitbaustein oder einen Controller/Server ausgelöst werden. Auch ist noch offen, ob für die Leuchten einheitlich Dimm-Aktoren eingesetzt werden oder je nach Leuchte in Dimm-Aktoren und Schalt-Aktoren zu unterscheiden ist. jb-2016_eg.indb 159 25.08.2015 9:43:44 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 160 Tabelle 1: Checkliste zur Auswahl der gewünschten Anforderung pro Raum (Beispiel) Gewünschte Anforderung pro Raum Anforderungen an Sensor -, Aktor - sowie V erarbeitungsfunktionen WZ Beleuchtung B1 Soll die Beleuchtung von mehreren Stellen aus gedimmt werden können? Taster (FS8); Lichtaktor -Dimmen (F A5) X B2 Soll es möglich sein, dass mehrere Leuchten über einen T asten - druck auf Lichtszenen eingestellt werden? Lichtszenentaster (FS9); Lichtaktor -Dimmen (F A5) B3 Soll es möglich sein, mit einem T aster mehrere Leuchten bzw . Leuchtengruppen auf einmal schalten oder dimmen zu können? Taster (FS8); Lichtaktor -Schalten/Lichtaktor -Dimmen (F A6) X B4 Soll sich die Beleuchtung bei An-/Abwesenheit automatisch ein- oder ausschalten? Präsenzerkennung (FS4); Lichtaktor -Schalten/Lichtaktor -Dimmen (F A6) B5 Soll sich die Helligkeit der Beleuchtung automatisch anpassen – d. h. bei erhöhtem T ageslichteinfall automatisch herunterdimmen? Helligkeitsmessung (FS12): T ageslichtschaltung/ Konstantlichtregelung (FV3); Lichtaktor -Dimmen (F A5) Verschattung V1 Soll es möglich sein, mehrere Rollläden/Jalousien gemeinsam zu fahren? Taster (FS8); Verschattungssteuerung (F A7) X V2 Soll es möglich sein, Zeitpläne für die V erschattung des Raums zu hinterlegen (d. h.T ages- oder W ochenprogramm)? Zeitprogramm (FS3); Verschattungssteuerung (F A7) X V3 Soll vermieden werden, dass der Rollladen für die T errassen-/ Balkontür gefahren wird, solange diese nicht von innen verschlos - sen ist (Aussperrschutz)? Fensterüber wachung (FS13); V erschattungssteuerung (F A7) V4 Soll beim Fahren derRollläden/Jalousien die Anwesenheit von Personen berücksichtigt werden (z. B. die Rollläden fahren nicht herunter , wenn sich eine Person im Raum be findet)? Präsenzerkennung (FS4); Logische V erarbeitungsfunktionen (FV5); Verschattungssteuerung (F A7) V5 Sollen die Rollläden/Jalousien in Abhängigkeit der Außenhelligkeit automatisch herauf- oder herunter fahren? Helligkeitsmessung (FS12); Logische V erarbeitungs- funktionen (FV5); V erschattungssteuerung (F A7) jb-2016_eg.indb 160 25.08.2015 9:43:44 Uhr
GEBÄUDEAUToMATIoN 3 161 Deshalb werden die Funktionen nicht, wie hier dargestellt, als sortierte Liste herausgeschrieben, sondern direkt als konkrete Kom-ponenten im Grundrissplan eingetragen. Dieser Vorgang wird im nachstehenden Beitrag „Projektierung der Sensorik und Aktorik für die Raumautomation im Smart Home“ ausführlich beschrieben. Tipp: Falls die Checkliste nicht mit einem Stift, sondern als Excel- Datei direkt mit dem PC ausgefüllt wird, sollten die Buchstaben „j“ (für „Ja“) und „n“ (für „Nein“) zur Beantwortung der Fragen verwen-det werden. Zum einen ist die Excel-Liste so formatiert, dass sich die Hintergrundfarbe der betreffenden Zelle grün bzw. rot färbt. Zum an-deren kann unterschieden werden, ob eine Frage explizit mit „Nein“ oder noch gar nicht beantwortet wurde. Tipp: Statt mit dem Fragebogen zu beginnen, kann auch direkt mit der Checkliste begonnen werden. Inhaltlich werden dieselben Fragen gestellt, aber auf vier Seiten komprimiert. Bei Bedarf kann die Checkliste auch vor einem Gespräch verändert und so auf jede Art von Kunde oder Projekt angepasst werden (irrelevante Zeilen können z. B. gelöscht werden). Literatur [1]: IGT-Richtlinie 02: Planung von Smarthome-Systemen, Institut für Gebäudetechnologie GmbH, 2014 [2] www.igt-institut.de/richtlinien AutorProf. Dr. Michael Krödel ist Professor für Gebäudeautomation und Gebäudetechnik an der Hochschule Rosenheim. Er ist parallel dazu Geschäftsführer des Instituts für Gebäudetechnologie, Mitglied im VDI Richtlinienausschuss zur VDI3813/3814 (Raum-/Gebäudeauto-mation) sowie in der Jury für den Award der Smart-Home-Initiative. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt darin, das Thema Gebäudeauto-mation über pragmatische Vorgehensweisen und Hilfsmittel für die Praxis anwendbar zu gestalten. www.igt-institut.de jb-2016_eg.indb 161 25.08.2015 9:43:44 Uhr